Heute
geschlossen
geschlossen
Dienstag bis Mittwoch 10:00 - 17:00
Donnerstag 10:00 - 19:00
Freitag bis Sonntag 10:00 - 17:00
Montag geschlossen
Dienstag bis Mittwoch und Freitag 10:00 - 18:00
Donnerstag 10:00 - 19:00
Samstag bis Montag geschlossen
Karfreitag 03.04.2026 10:00 - 17:00
Karsamstag 04.04.2026 10:00 - 17:00
Ostersonntag 05.04.2026 10:00 - 17:00
Ostermontag 06.04.2026 10:00 - 17:00
Sechseläuten 20.04.2026 10:00 - 17:00
Tag der Arbeit 01.05.2026 10:00 - 17:00
Auffahrt 14.05.2026 10:00 - 17:00
Pfingsten 24.05.2026 10:00 - 17:00
Pfingstmontag 25.05.2026 10:00 - 17:00
Nationalfeiertag 01.08.2026 10:00 - 17:00
Lange Nacht der Museen 05.09.2026 10:00 - 17:00
18:00 - 23:59
Lange Nacht der Museen 06.09.2026 0:00 - 2:00
10:00 - 17:00
Knabenschiessen 14.09.2026 geschlossen
Familientag 18.10.2026 10:00 - 17:00
21.12.2026 10:00 - 17:00
22.12.2026 10:00 - 17:00
23.12.2026 10:00 - 17:00
Heiliger Abend 24.12.2026 10:00 - 14:00
Weihnachten 25.12.2026 10:00 - 17:00
Stephanstag 26.12.2026 10:00 - 17:00
27.12.2026 10:00 - 17:00
28.12.2026 10:00 - 17:00
29.12.2026 10:00 - 17:00
30.12.2026 10:00 - 17:00
Silvester 31.12.2026 10:00 - 17:00
Neujahr 01.01.2027 10:00 - 17:00
Berchtoldstag 02.01.2027 10:00 - 17:00
accessibility.openinghours.special_opening_hours.link
Alle anzeigengeschlossen
Dienstag bis Mittwoch 10:00 - 17:00
Donnerstag 10:00 - 19:00
Freitag bis Sonntag 10:00 - 17:00
Montag geschlossen
Dienstag bis Mittwoch und Freitag 10:00 - 18:00
Donnerstag 10:00 - 19:00
Samstag bis Montag geschlossen
Karfreitag 03.04.2026 10:00 - 17:00
Karsamstag 04.04.2026 10:00 - 17:00
Ostersonntag 05.04.2026 10:00 - 17:00
Ostermontag 06.04.2026 10:00 - 17:00
Sechseläuten 20.04.2026 10:00 - 17:00
Tag der Arbeit 01.05.2026 10:00 - 17:00
Auffahrt 14.05.2026 10:00 - 17:00
Pfingsten 24.05.2026 10:00 - 17:00
Pfingstmontag 25.05.2026 10:00 - 17:00
Nationalfeiertag 01.08.2026 10:00 - 17:00
Lange Nacht der Museen 05.09.2026 10:00 - 17:00
18:00 - 23:59
Lange Nacht der Museen 06.09.2026 0:00 - 2:00
10:00 - 17:00
Knabenschiessen 14.09.2026 geschlossen
Familientag 18.10.2026 10:00 - 17:00
21.12.2026 10:00 - 17:00
22.12.2026 10:00 - 17:00
23.12.2026 10:00 - 17:00
Heiliger Abend 24.12.2026 10:00 - 14:00
Weihnachten 25.12.2026 10:00 - 17:00
Stephanstag 26.12.2026 10:00 - 17:00
27.12.2026 10:00 - 17:00
28.12.2026 10:00 - 17:00
29.12.2026 10:00 - 17:00
30.12.2026 10:00 - 17:00
Silvester 31.12.2026 10:00 - 17:00
Neujahr 01.01.2027 10:00 - 17:00
Berchtoldstag 02.01.2027 10:00 - 17:00
accessibility.openinghours.special_opening_hours.link
Alle anzeigenGeschichten und Gespräche aus dem Landesmuseum Zürich: Hochkarätige Gesprächspartner aus dem In- und Ausland diskutieren über historische und gesellschaftsrelevante Themen. Dazu kommen exklusive Podcasts zu Themen aus den Ausstellungen.
History Talks vom 26. November 2025
Die direkte Demokratie gilt als Herzstück des politischen Systems der Schweiz und macht es weltweit einzigartig. Zu den wichtigsten Instrumenten gehören Volksabstimmungen, die der Bevölkerung eine wesentliche Mitwirkung an politischen Entscheidungen ermöglichen. Doch wie selbstverständlich ist die direkte Demokratie wirklich, und wie haben Volksabstimmungen die Schweiz verändert? Wie nimmt die Bevölkerung ihre Rechte wahr, wer durfte und darf abstimmen – und wer bleibt ausgeschlossen? Und gibt es Grenzen der Demokratie, oder soll das Volk über alles abstimmen dürfen – selbst über Anliegen, die möglicherweise menschenrechtswidrig sind?
Der Historiker David Hesse und der Journalist Philipp Loser diskutieren mit Bundeskanzler Viktor Rossi über die Geschichte der Volksabstimmungen, die aktuellen Spannungsfelder und die Zukunft der direkten Demokratie.
Moderation: Priscilla Imboden, Bundeshaus-Redaktorin des Onlinemagazins "Republik"
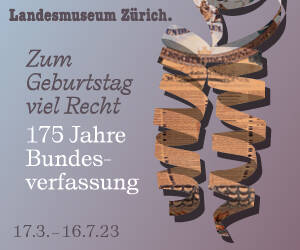
Der Kaufmann Hermann Amann handelte mit Kosmetikgeräten. 1981 klingelte beim ihm das Telefon, jemand aus der sowjetischen Botschaft bestellte ein Enthaarungsgerät. Dieser Anruf machte Hermann Amann für die Schweiz zum Verdächtigen – der Geheimdienst legte eine Fiche an. Als der Kaufmann von seiner Überwachung erfährt, prozessiert er und geht bis vor den Gerichtshof für Menschenrechte. Sein Anwalt, Ludwig Minelli, berichtet von diesem Fall.
Früher verloren Schweizer Frauen ihr Bürgerrecht, wenn sie einen Ausländer heirateten. Diese sogenannte Heiratsregel galt bis 1952. Davon betroffen war auch die Grossmutter von Marc Schumacher. Er erzählt in dieser Episode des Podcasts von seiner bewegten Familien-Geschichte um die Schweizer Staatsbürgerschaft.
La Genevoise Lucia Dahlab, une enseignante d’école primaire convertie à l'islam, porte un foulard dans sa salle de classe. Les autorités scolaires et les tribunaux veulent le lui interdire. Elle n'accepte pas cette interdiction et va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Dans cet épisode, Lucia Dahlab raconte son combat. Et pourquoi elle le considère aussi comme un combat féministe.
Dans les années 80, Marlène Belilos est active au sein du mouvement autonome «Lôzane bouge». Lorsqu'elle reçoit une amende pour avoir participé à une manifestation à laquelle elle n'a pas pris part et qu'elle n'a pas la possibilité de contester l'amende, elle décide de se battre. Son parcours la mène jusqu'à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme.
La storia del Ticino moderno è la storia di un cantone che ha sempre difeso la sua autonomia, ma che per affinità ideologiche e culturali ha condivio gli ideali risorgimentali con l’Italia: per la «madre di sangue» ha rappresentato per tutto l’Ottocento una terra d’accoglienza e di asilo per gli esuli politici italiani. E centinaia di ticinesi hanno combattuto nelle guerre di indipendenza; fra questi anche lo scultore Vincenzo Vela. Ne abbiamo parlato con lo storico Carlo Agliati e la direttrice del Museo Vela di Ligornetto Gianna Mina.
Der Podcast wurde produziert von audiobande

Die Gegenreformation, der Dreissigjährige Krieg und die fortschreitende Kolonisierung prägen die Epoche des Barock. Die Zirkulation von Waren und Wissen wird durch den Ausbau von weltweiten Handelsnetzwerken beschleunigt. Die Eidgenossenschaft ist Teil dieser globalen Verflechtungsprozesse. Roberto Zaugg, Professor für Allgemeine und Schweizer Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Zürich, spricht in dieser Folge mit Erik Thurnherr, Texetera, über die Vielschichtigkeit des Barock und deren politische und wirtschaftliche Zusammenhänge.
Was bedeutet es, eine Frau zu sein im Barock? Haben Frauen zu dieser Zeit überhaupt Zugang zu Bildung? Inwiefern unterscheiden sich die Rechte einer verheirateten von einer unverheirateten Frau? Und was für Rollenbilder bestimmen die Zeit? Claudia Opitz-Belakhal, Professorin für Neure Geschichte an der Universität Basel und Erik Thurnherr, Texetera, nehmen in dieser Folge die Hörenden mit auf einen sozialgeschichtlichen Rundgang und sprechen über das Leben von Frauen im Barock in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten – von der Naturforscherin bis hin zur Mätresse.
Im Zuge der katholischen Reformbewegungen werden in ganz Europa prachtvolle Kirchen und bedeutende Paläste errichtet. Die Nachfrage nach barocker Baukultur als Zeichen kirchlicher und staatlicher Repräsentation ist gross. In dieser Folge spricht Axel Christoph Gampp, Professor am Kunsthistorischen Seminar der Universität Basel und an der Berner Fachhochschule mit Erik Thurnherr, Texetera, über die massgebliche Beteiligung von Tessiner Architekten an der barocken Gestaltung von Rom und erläutert, wie Graubündner Baumeister die italienisierende Formensprache in den süddeutschen Raum transferiert haben.
Im 20. Jahrhundert erfährt der Barockbegriff eine Aktualisierung. Er wird nicht mehr nur als Epochen- oder Stilbezeichnung verwendet, sondern als kreatives, quasi universal übertragbares Konzept eingeführt. Gabrielle Schaad, Kunsthistorikerin und Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste und an der TU München und Erik Thurnherr, Texetera, gehen in dieser Podcast-Folge den Ursprüngen des Barock-Begriffs nach und erklären, dass barocke Konzepte wie Ensembleschöpfungen, Immersion oder Raumillusion bis in die heutige Zeit nachhallen.
Durant le règne de Louis XIV, tous les regards sont tournés vers la France. À une époque marquée par bon nombre de crises et de guerres, le roi de France développe la vie à la cour et mène à son apogée la production de luxe dans les domaines de la décoration d’intérieurs, des arts décoratifs et de la mode. Dans cette épisode, Thierry Sarmant, archiviste, historien et conservateur général aux Archives nationales à Paris, parle avec Florence Grivel de la création des manufactures royales et des multiples facettes de la personnalité de Louis XIV.
L’invenzione del cannocchiale e del microscopio incarna in modo esemplare la nuova concezione del mondo in epoca barocca, un periodo contraddistinto da viaggi di artisti ed eruditi, dalla fondazione di accademie e dalla costituzione di collezioni. L’esplorazione empirica della natura coinvolge anche personalità svizzere quali Johann Jacob Scheuchzer o Maria Sibylla Merian. In questo episodio Brigitte Schwarz e Simona Boscani Leoni, professoressa di storia moderna all’Università di Losanna, getta uno sguardo sull’universo degli studiosi dell’epoca, mostrando come la Svizzera fosse pienamente integrata in questa vasta rete di ricerche e innovazioni.
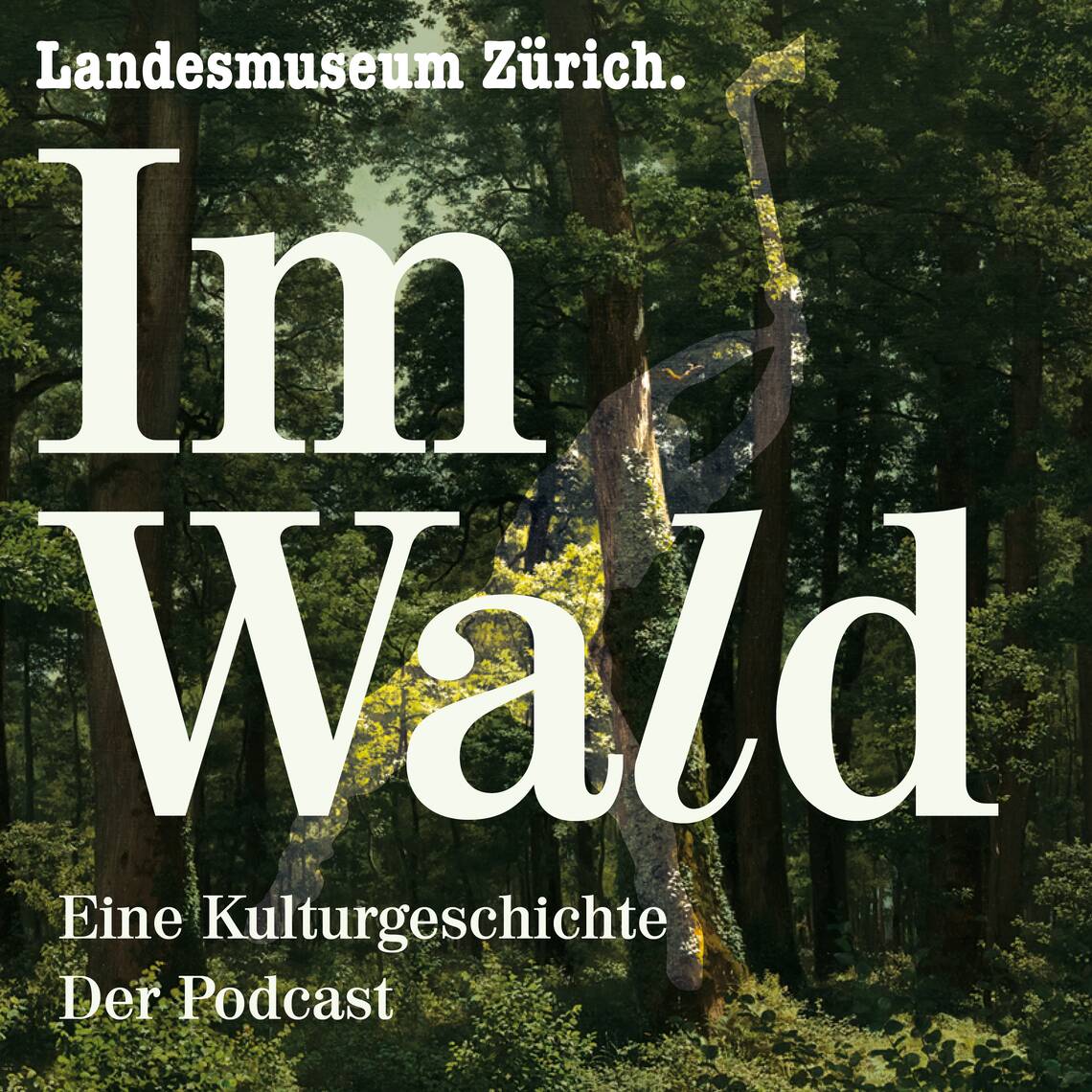
Publiziert am 15. März 2022
Der Wald ist weltweit in Gefahr, und zugleich ist der Wald so etwas wie unsere Lebensversicherung. In diesem Spannungsfeld, sagen die Kuratorinnen Pascale Meyer und Regula Moser, ist die Idee zu dieser Ausstellung entstanden. Sie erzählen, was die Ausstellung zeigt, und was der Podcast vermitteln will, mit einem historischen, dokumentarischen, und auch kunsthistorischen Blick auf den Wald.
Die Wälder im Engadin befanden sich, wie an vielen Orten der Schweiz, zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einem desolaten Zustand: gerodet, heruntergewirtschaftet, ausgebeutet. Drei Männer, Steivan Bruneis, Johann Wilhelm Coaz und Paul Sarasin, nahmen sich des Problems an und schufen den Schweizerischen Nationalpark. Was die drei Männer auch noch motivierte, erzählen Hans Lozza, Medienverantwortlicher beim Schweizerischen Nationalpark, und Patrick Kupper, Historiker an der Universität Innsbruck.
Als die Künstlerin Anita Guidi 1945 gemeinsam mit dem Ingenieur Armin Caspar ins Gebiet des Rio Negro aufbrach, war der Amazonas schon nicht mehr intakt. Holzschlag, moderne Landwirtschaft und Kautschukgewinnung hinterliessen bereits tiefe Spuren. Aus ähnlichen Gründen dokumentieren im Gran Chaco, einige tausend Kilometer südlich, indigene Künstler das Leben im Wald. Mit Ursula Regehr und Alexander Brust, beide Kurator/innen am Museum der Kulturen in Basel.
Nicht immer, sagt Daniel Maynard, Ökologe am Crowtherlab der ETH Zürich, ist das Pflanzen von Bäumen sinnvoll, um etwas gegen die Klimaerwärmung zu tun. Weil ein Wald eben mehr ist als eine Ansammlung von Bäumen, er ist ein hoch komplexes Ökosystem. Und deshalb brauche es mehr, als nur Baumpflanzungen, sagt Daniel Maynard im Gespräch mit Christoph Keller, es brauche einen umfassenden Schutz der bestehenden Wälder. Damit diese sich wieder ausbreiten können.
Als Bruno Manser im Jahr 2000 im tiefen Wald von Sarawak verschollen blieb, verstummte eine gewichtige Stimme für den Regenwald. Denn Bruno Manser war mehr als ein Abenteurer, ein Dokumentalist, ein Mahner – er hat das Bewusstsein für die Bedeutung der Regenwälder in die Schweiz und nach Europa gebracht. Was Bruno Manser antrieb, wie er sich Gehör verschaffte, und warum er für manche auch eine Projektionsfläche war, erzählt Lukas Straumann, Geschäftsführer des Bruno Manser Fonds, im Gespräch mit Christoph Keller.
Lange war der Wald in der Kunst nur ein Dekor, ein Hintergrund. In der Romantik wird er zum geheimnisvollen, erhabenen Ort stilisiert. Und dies gerade weil er im Zuge der Industrialisierung ein zunehmend gefährdeter Ort war. Das gilt auch für die Literatur, die dem Wald grossen Raum gibt, gerade auch im Nature Writing, einer Kunstform zwischen wissenschaftlicher Dokumentation und Literatur. Wir unternehmen eine Zeitreise von Caspar David Friedrich zu Beuys und von Rousseau zu Walser, in Begleitung der Kuratorin und Kunsthistorikerin Regula Moser und des Literaturwissenschaftlers Stefan Zweifel.
Der Wald ist ein komplexer Organismus, und er ist schwierig zu verstehen. Aber wir können ihn erfahren, spüren, wir können teilhaben an der speziellen Waldatmosphäre, wenn wir in den Wald eintauchen – dann ahnen wir etwas von dem, was den Wald ausmacht. Die Forstwirtin Marlèn Gubsch kennt den Wald als Wissenschaftlerin, aber sie kennt ihn auch als Erlebnisort. Dann, wenn sie mit Menschen in den Wald geht, um darin zu baden, sagt sie im Gespräch mit Christoph Keller.
Publiziert am 5. November 2021
Vor 6000 Jahren beginnen die Menschen in Europa, grosse Steinskulpturen nach ihrem Abbild zu errichten. Die Wechselausstellung im Landesmuseum Zürich vereint solche Stelen aus der Schweiz und Europa und bietet einen einmaligen Einblick in die Lebenswelt der Menschen in der Jungsteinzeit. Jacqueline Perifanakis, Co-Kuratorin, erklärt, welche Bedeutung diese geheimnisvollen Skulpturen haben und was sie uns über ihre Erschaffer verraten. Einen Blick hinter die Kulissen dieser aussergewöhnlichen Ausstellung bietet Co-Kurator Luca Tori.
Publiziert am 23. April 2021
Seit die Menschen- und Bürgerrechte von 1789 die «freien Männer» für politisch mündig erklärt haben, kämpfen Frauen für Gleichberechtigung. Und noch heute wird diese von Frauen und Männern verhandelt. Der Rundgang durch die Ausstellung «Frauen.Rechte» mit der Direktorin Denise Tonella und den Co-Kuratorinnen Erika Hebeisen und Noemi Crain führt von der Aufklärung in die Gegenwart. Anhand von Ausschnitten aus den Hörstationen erhalten Persönlichkeiten aus der Geschichte wie Mary Wollstonecraft, Franziska Tiburtius oder Emilie Lieberherr eine Stimme und bieten einen Einblick in die Debatten der jeweiligen Zeit.
Publiziert am 3. November 2020
In diesem zweiteiligen Podcast gehen wir mit den beiden Gastkuratoren Juri Steiner und Stefan Zweifel durch die Ausstellung und treffen auf gefallene Helden und leidende Körper, aber auch auf kreative Aussenseiter und alternative Lebensentwürfe, die uns Hoffnung für künftige Möglichkeiten geben.
Im ersten Teil schauen wir auf Männlichkeitsbilder der Antike, des Mittelalters und der Zeit vor dem ersten Weltkrieg.
Publiziert am 5. November 2020
In diesem zweiteiligen Podcast gehen wir mit den beiden Gastkuratoren Juri Steiner und Stefan Zweifel durch die Ausstellung und treffen auf gefallene Helden und leidende Körper, aber auch auf kreative Aussenseiter und alternative Lebensentwürfe.
Im zweiten Teil nehmen wir das 20. Jahrhundert in den Blick und sehen, wie sich nach dem Rückzug ins Innere und den radikalen Forderungen nach Selbstbestimmung neue Möglichkeiten eröffnen.
Publiziert am 4. Mai 2020
In diesem fünfteiligen Podcast nehmen wir Sie, zusammen mit den Kuratorinnen Christine Keller und Roberta Spano, mit auf eine Reise ins Mittelalter in die Welt der Nonnen. Anhand von verschiedenen Persönlichkeiten erfahren Sie, wie vielfältig die Lebensformen geistlicher Frauen im Mittelalter waren. Im ersten Teil dieses Podcasts gehen wir der Frage nach, was es für eine Frau im Mittelalter bedeutete, in ein Kloster einzutreten. Warum gingen Frauen ins Kloster und wie sah dort ihr Alltag aus?
Publiziert am 8. Mai 2020
Einige Frauenklöster hatten im Mittelalter viel Macht und Einfluss. Sie herrschten über grosse Ländereien, erteilten Aufträge zum Bau von Kirchen und Klöstern und einige der Äbtissinnen empfingen selbstbewusst hohe Kirchenvertreter, Könige oder gar den Kaiser. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Roberta Spano erzählt von Machtsymbolen und den Rechten der Frauen innerhalb der Kirche. Es kommen auch die Nonnen Elisabeth von Wetzikon und Pétronille de Chemillé zu Wort.
Publiziert am 12. Mai 2020
Im Mittelalter war das Kloster der einzige Ort, in dem Frauen eine Bildung erhalten konnten. Nonnen wie Hildegard von Bingen oder Herrad von Landsberg treten als hochgebildete Frauen hervor. Ihre Schriften und Werke finden grosse Anerkennung und prägen die Theologie der Kirche und das Wissen ihrer Zeit weit über die Klostermauern hinaus. Kuratorin Christine Keller zeigt dies anhand der reich illustrierten Bücher und aufwändig gestalteten Textilien in der Ausstellung.
Publiziert am 15. Mai 2020
Einige Nonnen gaben sich einer besonders emotional und körperlich gelebten Frömmigkeit hin. In Visionen und Ekstasen strebten sie nach einer mystischen Vereinigung mit ihrem spirituellen Bräutigam Jesus Christus. Besonders als Mystikerinnen bekannt sind Elsbeth Stagel, eine Nonne aus dem Kloster Töss und Adelheid Pfefferhart, die im Kloster Katharinental ein Gnadenerlebnis hatte.
Publiziert am 19. Mai 2020
Auch im Mittelalter gehen Reformbewegungen nicht spurlos an den Klöstern vorbei. Das Aufeinandertreffen von freiheitsliebenden Nonnen und Reformern, die strenge Disziplin einfordern, führt zu Konflikten.
History Talks vom 3. Dezember 2025
Warum ziehen sich Libertarismus und Autoritarismus gegenseitig an? Die einen plädieren für individuelle Freiheit und Eigenverantwortung und sind überzeugt, dass der Staat so wenig wie möglich in das Leben der Menschen eingreifen soll. Die anderen setzen auf Autorität, Gehorsam und Unterordnung und auf Systeme, in der die Macht in den Händen einer Person, einer Partei oder einer kleinen Elite konzentriert wird.
Was passiert, wenn beide miteinander verschmelzen? Warum finden libertäre Autoritäten so viele Anhängerinnen und Anhänger? Und steckt dahinter vielleicht sogar eine Lust an der Zerstörung? Diesen Fragen gehen die renommierte Soziologin Carolin Amlinger und der renommierte Soziologe Oliver Nachtwey nach. Bereits in ihrem viel beachteten Buch «Gekränkte Freiheit» haben sie den Rechtsrutsch und das Erstarken neuer Autoritäten analysiert. Im 2025 erschienenen Buch «Zerstörungslust» liefern sie nun eine Erklärung: Im Kern richtet sich diese Revolte gegen die Blockaden liberaler Gesellschaften, die ihre Versprechen von Aufstieg und Emanzipation nicht mehr einlösen. Die Zerstörung der Welt sei ein letzter Versuch, sich davor zu retten, von ihr zermalmt zu werden.
Moderation: Peer Teuwsen, Redaktionsleiter Kultur der «NZZ am Sonntag»
History Talks vom 26. November 2025
Die direkte Demokratie gilt als Herzstück des politischen Systems der Schweiz und macht es weltweit einzigartig. Zu den wichtigsten Instrumenten gehören Volksabstimmungen, die der Bevölkerung eine wesentliche Mitwirkung an politischen Entscheidungen ermöglichen. Doch wie selbstverständlich ist die direkte Demokratie wirklich, und wie haben Volksabstimmungen die Schweiz verändert? Wie nimmt die Bevölkerung ihre Rechte wahr, wer durfte und darf abstimmen – und wer bleibt ausgeschlossen? Und gibt es Grenzen der Demokratie, oder soll das Volk über alles abstimmen dürfen – selbst über Anliegen, die möglicherweise menschenrechtswidrig sind?
Der Historiker David Hesse und der Journalist Philipp Loser diskutieren mit Bundeskanzler Viktor Rossi über die Geschichte der Volksabstimmungen, die aktuellen Spannungsfelder und die Zukunft der direkten Demokratie.
Moderation: Priscilla Imboden, Bundeshaus-Redaktorin des Onlinemagazins "Republik"
History Talks vom 11. November 2025
Die heute nicht mehr gebräuchliche Diagnose «Hysterie» zeugt von historischen Vorstellungen von Geschlecht: Sie wurde über Jahrhunderte fast ausschliesslich Frauen gestellt. Bis ins 20. Jahrhundert hinein galten bestimmte Verhaltensweisen und psychische Auffälligkeiten als geschlechterspezifisch – Geschlecht beeinflusste, was als normal oder behandlungsbedürftig galt.
Heute wird das binäre Geschlechterverständnis zunehmend infrage gestellt. Queere und nichtbinäre Perspektiven rücken ins Zentrum gesellschaftlicher Debatten – und werfen neue Fragen auf: Welche Auswirkungen haben Geschlechtsidentitäten auf unsere Psyche? Wie erleben Menschen psychische Gesundheit im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Erwartungen, Selbstbild und Zugehörigkeit?
Darüber sprechen Anna Rosenwasser, Nationalrätin und Autorin, und Monika Gsell, Psychoanalytikerin und Kulturwissenschaftlerin. Sie beleuchten, wie sehr unser Innenleben und gesellschaftliche Zuschreibungen miteinander verwoben sind – und wie wir darüber neu sprechen können.
Moderation: Christina Caprez
History Talks vom 25. August 2025
Die Welt war wohl nie ein heiler Ort: Schon aus der Zeit der frühesten Zivilisationen sind Delikte wie Mord oder Diebstahl bekannt. Auch die Literatur griff solche Untaten bereits in der Antike auf. Gehört das Verbrechen also einfach zum Menschsein? So einfach ist die Sache nicht, das zeigt die Geschichte der Kriminalität: Die Taten, die begangen und geahndet werden, variieren je nach Zeit und Gesellschaft. Eigentumsdelikte zum Beispiel, die heute in der Kriminalstatistik dominieren, landeten bis ins 18. Jahrhundert nur selten vor Gericht.
Was steckt hinter solchen Entwicklungen, und was ist aus der Vergangenheit für den heutigen Umgang mit Kriminalität zu lernen? «NZZ Geschichte» spricht mit dem Kriminalitäts- und Strafrechtshistoriker Joachim Eibach und dem Literaturwissenschafter Manuel Bauer darüber, was Verbrechen über die Normen einer Gesellschaft aussagen – und wieso sie mit den Krimis jene Bücher prägen, die viele Menschen am liebsten lesen.
Darüber diskutieren Manuel Bauer, Literaturwissenschafter und Joachim Eibach, Historiker. Moderation: Claudia Mäder, Leiterin von NZZ Geschichte
Der Anlass fand in Zusammenarbeit mit NZZ Geschichte statt.
History Talks vom 27. Mai 2025
30 Jahre ist es her, dass die offene Drogenszene auf dem Zürcher Letten geräumt wurde. Damit endete ein kollektives Trauma, das auf dem Platzspitz begonnen hatte. Was haben Zürich und die Schweiz aus dieser Zeit gelernt, was lief damals schief, was letztlich gut?
Und wie sieht es heute aus angesichts der Crack- und Fentanyl-Krise, die gerade weltweit um sich greift? Die von globalen Krisen geprägte Weltlage fördert den Konsum von Suchtmitteln, während Drogen immer günstiger werden und leichter zu beschaffen sind. Hat es Zürich, wie einige postulieren, tatsächlich besser im Griff als andere europäische Städte? Oder stehen wir in der Schweiz doch vor der nächsten Katastrophe?
Darüber diskutieren André Seidenberg, ehemaliger «Platzspitz-Arzt» und Pionier der Schweizer Drogenpolitik, Michael Herzig, Historiker, Mitherausgeber des Buches «Die Schweiz auf Drogen» sowie langjähriger Drogenbeauftragter der Stadt Zürich und Julia Zutavern, die jahrelang für eine Serie zum Thema Zürcher Drogenpolitik recherchierte.
Der Anlass findet in Zusammenarbeit mit Einfach Zürich statt.
History Talks vom 6. Mai 2025
Früher gab es Musik für die Eliten und Musik fürs Volk. Dann rollte die Popkultur als Massenphänomen heran. Vinylplatte, Walkman, Sampler und Streaming legten den Boden für neue Produktions- und Verbreitungsverfahren. Von Rock bis Techno entstanden kommerziell höchst erfolgreiche Musikszenen, die alles durchdrangen – das politische Denken, die Kleidungsstile, die Lebensformen. Wie entstand diese globalisierte Konsumkultur?
Der Kulturjournalist Tobi Müller, der Historiker Erich Keller und die DJ Rosanna Grüter diskutieren über die gesellschaftliche Sprengkraft von Tonträgern und Tönen.
Moderation: Theresa Beyer, Leiterin Musikredaktion bei SRF Kultur
History Talks vom 1. April 2025
Historia magistra vitae – die Geschichte ist die Lehrmeisterin des Lebens. Diese Wendung zirkuliert seit der Antike, aber heute hat man Mühe, ihr etwas abzugewinnen: Dass die Menschen aus der Geschichte lernen, scheint in Zeiten von nicht enden wollenden Kriegen, neu erstarktem Autoritarismus und fortdauernder Umweltzerstörung wenig plausibel. Eher wirkt es, als würden die Menschen immer wieder dieselben Fehler machen. Zugleich ist nicht zu bestreiten, dass sich viele Dinge verbessert haben auf der Welt. Die Menschen haben durchaus gelernt: Krankheiten zu heilen, funktionierende Demokratien aufzubauen oder Frauen an die Urne zu lassen.
Was also lehrt uns die Geschichte? Gibt der Blick in die Vergangenheit Anlass, auf weiteren Fortschritt zu hoffen? Was ist Fortschritt eigentlich genau, und ist es überhaupt möglich, aus vergangenen Zeiten etwas Aussagekräftiges für Gegenwart und Zukunft abzuleiten? Die Historikerin Ute Frevert und der Historiker Caspar Hirschi wagen sich zum 10jährigen Jubiläum des Magazins «NZZ Geschichte» an diese ganz grossen Fragen.
Moderation: Claudia Mäder, Leiterin NZZ Geschichte und Daniel di Falco, Redaktor NZZ Geschichte
History Talks vom 4. März 2025
Ab Ende der 1960er Jahre begann die Schweiz, jugoslawische Arbeitskräfte in die Schweiz zu holen – die florierende Wirtschaft brauchte sie, und das liberale Ausreiseregime unter Tito begünstigte die Arbeitsmigration. Die Zahl der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter nahm in den folgenden Jahrzehnten zu. Mit dem Ausbruch des Kriegs Anfang der 1990er Jahre kamen auch zahlreiche Flüchtende dazu. Um die Jahrtausendwende machten die Personen aus Ex-Jugoslawien fast einen Viertel der ausländischen Wohnbevölkerung der Schweiz aus.
Heute bilden Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien eine der grössten Ausländergruppen in der Schweiz. Viele der Ausgewanderten und vor allem ihre Kinder sind integrale Mitglieder des Schweizer Sozialgefüges. Lange aber wurden Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien als Fremd betitelt und stiessen so auf Ablehnung innerhalb der Gesellschaft.
Der Historiker Damir Skenderovic und die Soziologin Sandra King-Savic sprechen über die Schweizer Migrations- und Asylpolitik, die Lage der Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, die Vorurteile, die ihnen entgegengebracht wurden sowie die Frage nach den Folgen des Krieges auf die ex-jugoslawische Diaspora.
Moderation: Inés Mateos, Expertin für Bildung und Diversität
History Talks from 6 February 2024
Cartoons have the ability to transcend culture, language and time barriers while evoking a range of emotions and delivering impactful messages. Some of them capture the spirit of the time so well that they become important testimonies of today for the future.
The Geneva-based Patrick Chappatte is a pioneer of graphic journalism and one of the worldwide best-known political cartoonists. His drawings are sharp – sometimes they even reach the pain threshold. In a discussion hosted by the renowned presenter Monika Schärer, Chappatte will talk about the power and powerlessness of a cartoonist, about the reactions and dangers of his profession and his passionate advocating for freedom of expression and press.
Listen here:
History Talks vom 4. Februar 2025
Historikerinnen und Historiker arbeiten mit Quellen und fragen, wie unlängst Jakob Tanner am Deutschen Historikertag, nach der «Fabrikation von Fakten». Schriftstellerinnen wie Melinda Nadj Abonji hingegen beziehen Fakten ein, um Fiktion zu schaffen. Und oft werden historische Romane als faktisch wahr gelesen.
Beide produzieren Narrative und pflegen dabei ihren je eigenen Umgang mit Fakten. Wie aber unterscheiden sich ihre jeweiligen Texte? Und was steht für Geschichte und Literatur auf dem Spiel, wenn in Politik und Medien von «alternativen Fakten» und fiktiven «News» die Rede ist?
Moderation: Erika Hebeisen, Historikerin und Kuratorin im Schweizerischen Nationalmuseum
History Talks vom 3. Dezember 2024
Heiraten wollte die Schweiz nicht. Aber trennen wollte sie sich auch nicht: Vor 25 Jahren unterzeichnete sie die ersten Bilateralen Verträge mit der EU. Seither ist ein ausgeklügeltes Regelwerk entstanden. Ist es noch tragfähig? Und wohin führt die Reise?
Die Rechtswissenschaftlerin Astrid Epiney und der Historiker Thomas Maissen ziehen Bilanz und diskutieren Chancen und Risiken des bilateralen Wegs. Sie fühlen einer Schweiz den Puls, die nicht zum ersten Mal zwischen Souveränität und Teilhabe schwankt.
Moderation: Peer Teuwsen, Redaktionsleiter Kultur der «NZZ am Sonntag»
History Talks vom 10. November 2024
Katharina von Zimmern, die letzte Äbtissin des Fraumünsterklosters und damit faktisch Herrin über Zürich, übergab die Abtei während der Reformation der Stadt – und verhinderte damit vielleicht einen Bürgerkrieg. Was bewog sie dazu? Und wieso halten andere an der Macht fest?
Die Historikerin Caroline Arni, der Soziologe Ueli Mäder und der Neuropsychologe Lutz Jäncke diskutieren darüber, was Macht mit Menschen macht – und was Menschen mit Macht machen. Wir fragen, warum es überhaupt Macht gibt, wer sie ausübt, wo sie produktiv ist und unter welchen Umständen sie toxisch wird. Moderation: Lea Haller
In Kooperation mit Einfach Zürich. Im Rahmen des Jubiläums «500 Jahre Katharina von Zimmern».
History Talks from 5 November 2024
In recent years, research has shown that phenomena such as globalization and climate change are closely interlinked with the history of colonialism. How do we explain this connection, what does it mean for the world today, and what form of responsibility do we draw from this? The anthropologist Shalini Randeria and the historian Debjani Bhattacharyya discuss the history of globalization and the climate crisis. They reveal how the issues are linked with colonialism and discuss what a responsible form of globalization could look like.
Host: Henri-Michel Yéré, historian and poet, University of Basel
Listen here:
History Talks vom 1. Oktober 2024
Autokraten sitzen fest im Sattel. In den USA kandidiert Donald Trump erneut für die Präsidentschaft. Die Europäische Union kämpft mit multiplen Krisen. Und in der Schweiz bröckelt das Selbstverständnis einer unantastbaren Insel der Glückseligen. Taugen die Versprechen der Demokratie noch für die Zukunft?
Die Historikerin Brigitte Studer und der Publizist Roger de Weck diskutieren darüber, was eine funktionierende Demokratie ausmacht, wen sie ermächtigt, wie sie sich im Lauf der Zeit verändert hat und wieso es nicht nur demokratische Institutionen braucht, sondern auch eine demokratische Kultur.
History Talks vom 3. September 2024
Wir leben in einer globalisierten Welt. Waren, Dienstleistungen und Menschen bewegen sich in hoher Frequenz von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent. Sind Grenzen damit unwichtig geworden? Das Gegenteil ist der Fall. Auch wenn man das Ein- und Aussortieren heute oft nicht mehr wahrnimmt, weil es digital oder in entfernten Gegenden passiert: Grenzkontrollen sind eine Obsession der Moderne.
Der Historiker André Holenstein und die Geografin Judith Miggelbrink diskutieren über Schmuggel, Flucht und regionale Wirtschaftsräume, über Kosmopolitismus und nationale Identität.
History Talks vom 5. Mai 2024
Die Schweiz gilt als Steueroase par excellence. Das Bankgeheimnis, politische Stabilität und niedrige Unternehmenssteuern locken seit langem ausländisches Kapital an. Wie kam es dazu? Wer kopierte das Modell? Und was hat das Steuerzahlen mit Recht und Moral zu tun?
Die Historikerin Korinna Schönhärl und der Historiker Tobias Straumann erläutern im Gespräch, wann die Steuerflucht aufkam, wie die Offshore-Industrie funktioniert und weshalb sie trotz Gegenmassnahmen bis heute nicht verschwunden ist.
History Talks vom 10. April 2024
Wir denken mit dem Kopf. Aber wir arbeiten, schlafen, lieben, gebären und sterben mit dem Körper. Hat dieser Körper eine Geschichte? Wie dachte man im Mittelalter über ihn, wie in der Moderne? Was erwartete man vom männlichen und vom weiblichen Körper, wie normierte man ihn – und was muss dieser Körper heute leisten?
Die Historikerin Caroline Arni und der Historiker Valentin Groebner diskutieren über Sex, Leichen und Tattoos, über Regeln und Regelverletzungen – über ein Leben, das ohne Körper nicht denkbar ist.
History Talks vom 5. März 2024
Historische Biografien haben Konjunktur, das geschriebene Leben fasziniert. Aber welche Lebensgeschichten sind überhaupt erzählbar? Und wie geht man mit der Geschichte um, wenn man das Leben der eigenen Familie rekonstruiert?
Die Historikerin und Kulturvermittlerin Lina Gafner und der Autor und Regisseur Gabriel Heim diskutieren über Vatersuche, Frauengeschichten und die Kraft von Lebensgeschichten im Spannungsfeld zwischen historischer Wahrheit und wahrhaftiger Fiktion.
History Talks vom 26. Januar 2024
Nella Svizzera di oggi una sensibilità meridionale fa ormai parte della vita quotidiana. L’italianità in Svizzera è legata sia alle immigrate e agli immigrati della vicina penisola che alle regioni italofone del nostro Paese. Come è percepita nelle diverse realtà regionali, sia al nord che al sud delle Alpi? L’italianità permea la Svizzera, ma allo stesso tempo alcuni sviluppi come la riduzione dell’insegnamento dell’italiano a nord delle Alpi preoccupano.
Il Consigliere federale Ignazio Cassis presenterà le sue riflessioni e visioni su questi temi, sollecitato dai giornalisti Maurizio Canetta, ex direttore della RSI, e Peter Jankovsky, collaboratore NZZ.
History Talks vom 3. Oktober 2023
Die Sprachen, die wir sprechen, prägen uns. Sie verraten, woher wir kommen und wo wir gelebt haben. Sie erzählen einen Teil unserer eigenen Geschichte. Sprachen sind Teil von Kultur und Gesellschaft, sie wirken gleichzeitig einschliessend und ausgrenzend. Inwiefern schaffen sie Identität? Was bedeutet die Mehrsprachigkeit in der Schweiz und was macht sie mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern? Welche Rolle spielen dabei neben den Landessprachen auch die Dialekte oder die Jugend- und Migrationssprachen?
Die Schriftstellerin und literarische Übersetzerin Zsuzsanna Gahse und der Kulturwissenschaftler Walter Leimgruber reflektieren im Gespräch mit der Journalistin Nicoletta Cimmino über die Kraft der Mehrsprachigkeit.
History Talks vom 27. Juni 2023
Während des Kalten Krieges baute die Schweiz die staatliche Überwachungstätigkeit stark aus und sammelte Daten über hunderttausende von Personen. Die Aufdeckung des Fichenskandals Ende der 1990er-Jahre entrüstete die Schweizer Öffentlichkeit. Verglichen mit dem «Datenhunger» heutiger Staaten und Unternehmen, wirken die damals angelegten Akten beinahe harmlos. Was bedeutet es für einen Menschen, wenn Daten über ihn gesammelt werden? Über diese zentralen Fragen diskutieren der ehemalige Bundesrichter Niklaus Oberholzer und die Geschichtsprofessorin Monika Dommann.
History Talks vom 1. März 2023
Wie steht es um die Frauenrechte in der Schweiz? Die Journalistin und Autorin Nina Kunz und die Politikerin und ehemalige Direktorin des Migros-Genossenschafts-Bunds, Monika Weber, ziehen Bilanz und wagen einen Blick in die Zukunft.
History Talks vom 14. November 2022
Barock ist mehr als eine Frage des Stils. Die Epoche zwischen 1580 und 1780 ist ein Zeitalter der Kontraste: Opulenz und Innovation auf der einen, Tod und Krisen auf der anderen Seite. In dieser vielgestaltigen Epoche werden Grundsteine unserer modernen Welt gelegt. Wie sehr wirkt sich diese Zeit heute noch auf uns aus? Welche Parallelen lassen sich zwischen dem Barock und dem Jetzt ziehen? Zehn Jahre nach ihrem Gespräch im Rahmen der «Sternstunde Philosophie» diskutieren Bice Curiger und Werner Oechslin zusammen mit Juri Steiner über die Kraft des Barock und die Unfassbarkeit dieses ersten globalen Stils.
History Talks vom 4. Oktober 2022
Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühle beruhen auf einem gemeinsamen Kulturerbe, das Ausdruck von der Kreativität und der Geschichte einer Gesellschaft ist. Deshalb ist die Gefährdung und Zerstörung kultureller Hinterlassenschaften durch Krieg, Katastrophen oder den Klimawandel so verheerend. Und deshalb sind die Fragen, wie dieses Kulturerbe geschützt werden kann, so relevant. Was bedeutet das Kulturerbe für die Menschen, die es verlieren? Wie können Kulturgüter im Krieg geschützt und erhalten werden? Wie sieht die Lage derzeit in der Ukraine aus?
History Talks vom 6. September 2022
Bald wird es keine Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des Holocaust mehr geben. Die Kraft der unmittelbaren Begegnung mit Überlebenden wird uns dann fehlen. Was bedeutet das für unsere Erinnerungskultur? Droht eine zunehmende Gleichgültigkeit? Oder verstehen wir diese Zäsur als Anlass, unserer Verantwortung umso stärker wahrzunehmen, das Gedenken an die Opfer aufrechtzuerhalten?
Fokus vom 21. März 2022
Der Kreml legitimiert seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine hauptsächlich mit historischen Reminiszenzen. Gibt es für diesen Krieg aber überhaupt historische Erklärungen? Mit einem Blick zurück in die Geschichte erörtern die Osteuropahistorikerin Nada Boškovska und der Militärhistoriker Michael M. Olsansky den Wandel von Zugehörigkeiten und Grenzverschiebungen im aktuell umkämpften Raum. Welche militärischen Strategien verfolgten Russland und die Sowjetunion früher bezüglich der Ukraine? Wie hat die historische Entwicklung das russisch-ukrainische Verhältnis geprägt? Welche Bilder und welche Ideologien bilden den Hintergrund dieses Kriegs, der jetzt in Europa tobt?
Dienstags-Reihe du 2 novembre 2021
Si la Suisse est un exemple de miracle économique, elle est tout autant – si ce n’est plus – un miracle politique. Un regard de l’extérieur sur un pays aux multiples facettes culturelles comme le nôtre est d’autant plus instructif. Qu’est-ce qui frappe les observateurs provenant d’autres pays polyglottes tels que le Canada ou le Luxembourg ? Quel est le degré de cohésion en Suisse par rapport à ces pays ? Et où peut-on déceler des failles?
Dienstags-Reihe vom 5. Oktober 2021
Seit über 250 Jahren ist das mächtigste Land der Welt demokratisch und liberal: Im 19. Jahrhundert war das Grossbritannien, seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind es die USA. Jetzt erleben wir den Aufstieg Chinas zu einer Weltmacht, die weder demokratisch noch liberal ist. Wie verändert das die Weltpolitik? Was bedeutet das für die im Westen verankerte, aber neutrale Schweiz? Und sieht die Schweizer Wirtschaft China weiterhin zurecht als Markt der Zukunft?
Dienstags-Reihe vom 7. September 2021
Der mächtigste Mann der Welt hat die Schweiz frontal angegriffen. Das Land sei eine Steueroase, die es trockenzulegen gelte! So redete US-Präsident Joe Biden, als er kürzlich eine Revolution im globalen Steuersystem ankündigte. Die Schweiz in der Rolle des Bösewichts: Das weckt Erinnerungen an den verlorenen Kampf um das Bankgeheimnis. Aber stimmt Bidens Erzählung auch? Haben wir nun ein Problem, weil die OECD mit Unterstützung der USA eine globale Mindeststeuer einfordern? Wankt gar das «Erfolgsmodell Schweiz»?
Dienstags-Reihe vom 4. Mai 2021
Das Gleichstellungsgesetz ist glasklar: Keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Trotzdem haben Mütter in der Schweiz schlechtere Karrierechancen und verdienen weniger («motherhood wage penalty»); hinzu kommt die unterdotierte Pensionskasse. Die Diskriminierung von Müttern erhält in der politischen Debatte kein grosses Gewicht. Wie lässt sich das ändern?
Dienstags-Reihe vom 6. April 2021
Das Verhältnis der Schweiz und der EU harrt weiter seiner Klärung. An welchem Punkt befinden wir uns in den Verhandlungen um den Rahmenvertrag? Ist ein Deal denkbar, mit dem beide Seiten langfristig gut leben können? Und wie steht es grundsätzlich um Europas Rolle in der multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts?
Dienstags-Reihe vom 1. September 2020
Die Schweizer Bevölkerung wächst seit Jahren stark. Was bedeutet das für unser Land – raumplanerisch, infrastrukturell, politisch? Muss sich die Schweiz künftig als grosse Stadt denken? Oder gilt nach der Corona-Krise das exakte Gegenteil? Wird statt Verdichtung nun soziale Distanz zum Gebot der Stunde, bis hin zu einer neuen Stadtflucht?
Dienstags-Reihe vom 3. März 2020
Es scheint, als habe Geld keinen Wert mehr: Tiefst- und Negativzinsen gehören heute zur Normalität. Kann die Wirtschaft dauerhaft mit «billigem» Geld angekurbelt werden, oder bezahlen wir in einigen Jahren die Rechnung dafür? Vor allem aber stellt sich die Frage: Kann unsere Wirtschafts- und Gesellschafts-ordnung die Ära des Gratisgeldes unbeschadet überleben?
Dienstags-Reihe vom 7. Januar 2020
Die Schweiz hat nach dem Zweiten Weltkrieg von der liberalen Weltwirtschaft und einer stabilen europäischen Gemeinschaft profitiert. Heute steht der Freihandel unter Druck und die EU sucht ihren Platz im Verhältnis zu den globalen Mächten Amerika und China. Was bedeutet das für die Schweiz? Müssen wir uns auf härtere Zeiten einstellen? Oder entstehen neue geopolitische und ökonomische Nischen, in denen die Schweiz auch künftig florieren kann?
Dienstags-Reihe vom 3. Dezember 2019
Alle vier Jahre muss sich der siebenköpfige Bundesrat den Gesamterneuerungswahlen stellen. Die Landesregierung ist wie die meisten Exekutiven auf Kantons- und Gemeindeebene eine Kollegialbehörde, die nach dem Konkordanz-Prinzip agiert. Ist eine solche Regierungsform überhaupt noch zeitgemäss? Oder handelt es sich dabei um ein Auslaufmodell, das sich ins 21. Jahrhundert gerettet hat? Im Rahmen der Dienstagsreihe diskutieren Bundeskanzler Walter Thurnherr und Markus Notter, langjähriger Zürcher Regierungsrat, über Politik, Regierungsformen und die Herausforderungen von Exekutiven in einer globalisierten und zunehmend digitalen Welt.
Dienstags-Reihe vom 4. Juni 2019
Der Krieg stellt ein schreckliches Faszinosum dar. Aber er passiert den Menschen immer wieder. Und die Folgen sind immer fürchterlich. Was können wir aus den europäischen Kriegen der Vergangenheit für die Gegenwart lernen? Darüber unterhält sich Robert Gerwarth, Autor von «Die Besiegten. Das blutige Erbe des Ersten Weltkriegs», mit Peer Teuwsen, Redaktionsleiter von «NZZ Geschichte». Gerwarth lehrt als Professor für Moderne Geschichte am University College in Dublin und ist Gründungsdirektor des dortigen Zentrums für Kriegsstudien.
Dienstags-Reihe vom 8. Januar 2019
Es liegt im Wesen des Jahreswechsels, dass er die Menschen ins Sinnieren bringt. Man blickt zurück, man blickt nach vorn, hat Hoffnungen und Ängste. Welche Sorgen und Zweifel, Erwartungen und Wünsche treiben die Menschen um? Wer gibt Halt in unsicheren Zeiten? Die Religion? Die Landeskirchen? Oder haben diese genug zu tun mit ihren eigenen Sorgen und Nöten? 2019 ist Zwinglijahr: Anlass genug für ein ökumenisches Gipfeltreffen zum Jahresanfang. Im Rahmen der Dienstags-Reihe im Landesmuseum Zürich, präsentiert vom Tages-Anzeiger, diskutierten der Basler Bischof Felix Gmür und der Zürcher Grossmünsterpfarrer Christoph Sigrist mit Hannes Nussbaumer, Leiter Ressort Zürich beim Tages-Anzeiger.
Dienstags-Reihe vom 6. März 2018
Die Angst vor einem grossen Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Die Kriege in der Ukraine, im Mittleren sowie im Nahen Osten lassen zweifeln, ob das 20. Jahrhundert tatsächlich als ein «kurzes Jahrhundert» 1989/90 zu Ende gegangen ist – oder nicht vielmehr auf unheilvolle Weise andauert. Herfried Münkler, Professor für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin, hat sich intensiv mit den europäischen Kriegen beschäftigt, etwa in seinem neuesten Buch «Der Dreissigjährige Krieg: Europäische Katastrophe, deutsches Trauma 1618-1648». Im Rahmen der Dienstags-Reihe im Landesmuseum Zürich, präsentiert von NZZ Geschichte, hat Redaktionsleiter Peer Teuwsen mit Herfried Münkler darüber gesprochen, wie sich Kriege anbahnen und welche Rolle die Religion dabei spielt.
Dienstags-Reihe vom 2. Mai 2017
Nach dem Ende des kalten Krieges verschwand Russland von der politischen Bildfläche. Viele Satellitenstaaten wurden eigenständig und Moskau war nicht mehr der Nabel der östlichen Welt. Doch seit ein paar Jahren sind die Russen zurück auf der grossen Weltbühne und der Westen fragt sich seither, was Putin im Schilde führt. Jörg Baberowski, Professor für die Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität Berlin, hat Russlands Vergangenheit und die Zeit des Stalinismus eingehend erforscht. Im Rahmen der Dienstags-Reihe im Landesmuseum Zürich, präsentiert von NZZ Geschichte, unterhält sich Redaktionsleiter Peer Teuwsen mit Jörg Baberowski über die Geschichte Russlands und wie sich Putins Ambitionen daraus erklären lassen. Ein interessanter Rück- und Ausblick auf die Weltmacht Russland.
Dienstags-Reihe vom 4. April 2017
Vladimir Putin ist in Russland nahezu unbestritten. Der grösste Teil der Bevölkerung steht hinter dem Präsidenten und seiner Politik. Ganz anders sieht es im Westen aus. Hier wird Putin von Medien und zahlreichen russischen Intellektuellen heftig kritisiert. Zu Recht oder nicht? Michail Schischkin ist einer der meist gefeierten russischen Autoren der Gegenwart. Er wurde 1961 in Moskau geboren, studierte Linguistik und unterrichtete Deutsch. Seit 1995 lebt er in der Schweiz, Moskau und Berlin. Seine Romane wurden national und international vielfach ausgezeichnet, unter anderem erhielt er als Einziger alle drei wichtigsten Literaturpreise Russlands. 2011 wurde ihm der Internationale Literaturpreis Haus der Kulturen der Welt in Berlin verliehen. Im Rahmen der Dienstags-Reihe im Landesmuseum Zürich, präsentiert von Reportagen, diskutiert Chefredaktor Daniel Puntas Bernet mit seinem Gast über den russischen Politiker und ergründet, wie es zu einer derart unterschiedlichen Wahrnehmung von Vladimir Putin kommen konnte.
Dienstags-Reihe vom 7. Februar 2017
Über kaum etwas wird so viel gesprochen wie über das Wetter. Im Alltag gilt das Interesse vor allem dem kommenden Wetter. Klimahistoriker Christian Pfister beschäftigt sich dagegen mit dem vergangenen Wetter. Der Blick auf dieses ist mindestens so faszinierend wie der Ausblick - und verschafft uns zudem wichtige, auch für Gegenwart und Zukunft relevante Einsichten über Klima- und Wetterveränderungen. Christian Pfister war Geschichtsprofessor an der Universität Bern, wirkt heute als freier Forscher, ist international renommierter Klimahistoriker und hat die Klimadatenbank Euro-Climhist aufgebaut. Im Rahmen der Dienstags-Reihe im Landesmuseum, präsentiert vom Tages-Anzeiger, unterhielt sich Hannes Nussbaumer, Ressortleiter, mit Christian Pfister über das Wetter von gestern und heute.
Dienstags-Reihe vom 6. September 2016
Sir Christopher Clark ist spätestens seit seinem Buch «Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog» ein Star seiner Branche. Der australische Historiker, der als Professor für Neuere Europäische Geschichte in Cambridge lehrt, zeigt darin minutiös auf, wie die europäischen Entscheidungsträger in einen vermeidbaren Krieg taumelten. Damit relativiert Clark die These von der Hauptverantwortung Deutschlands für diesen Weltkrieg, was in Deutschland heftige Kontroversen auslöste. Im Rahmen der Dienstags-Reihe im Landesmuseum Zürich, präsentiert von NZZ Geschichte, unterhielt sich Chefredaktor Peer Teuwsen mit Clark über sein Werk und die Aktualität von Geschichte.