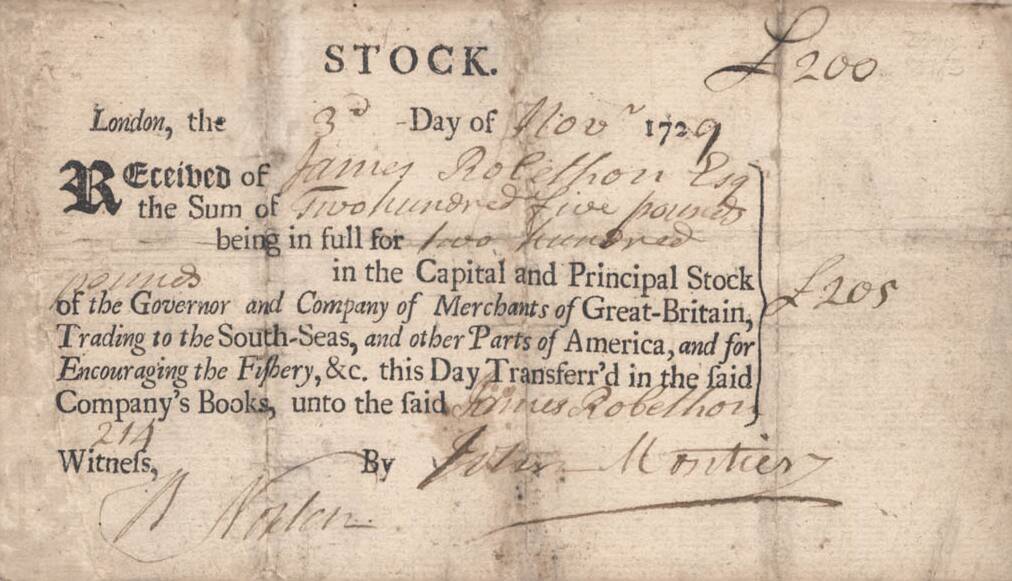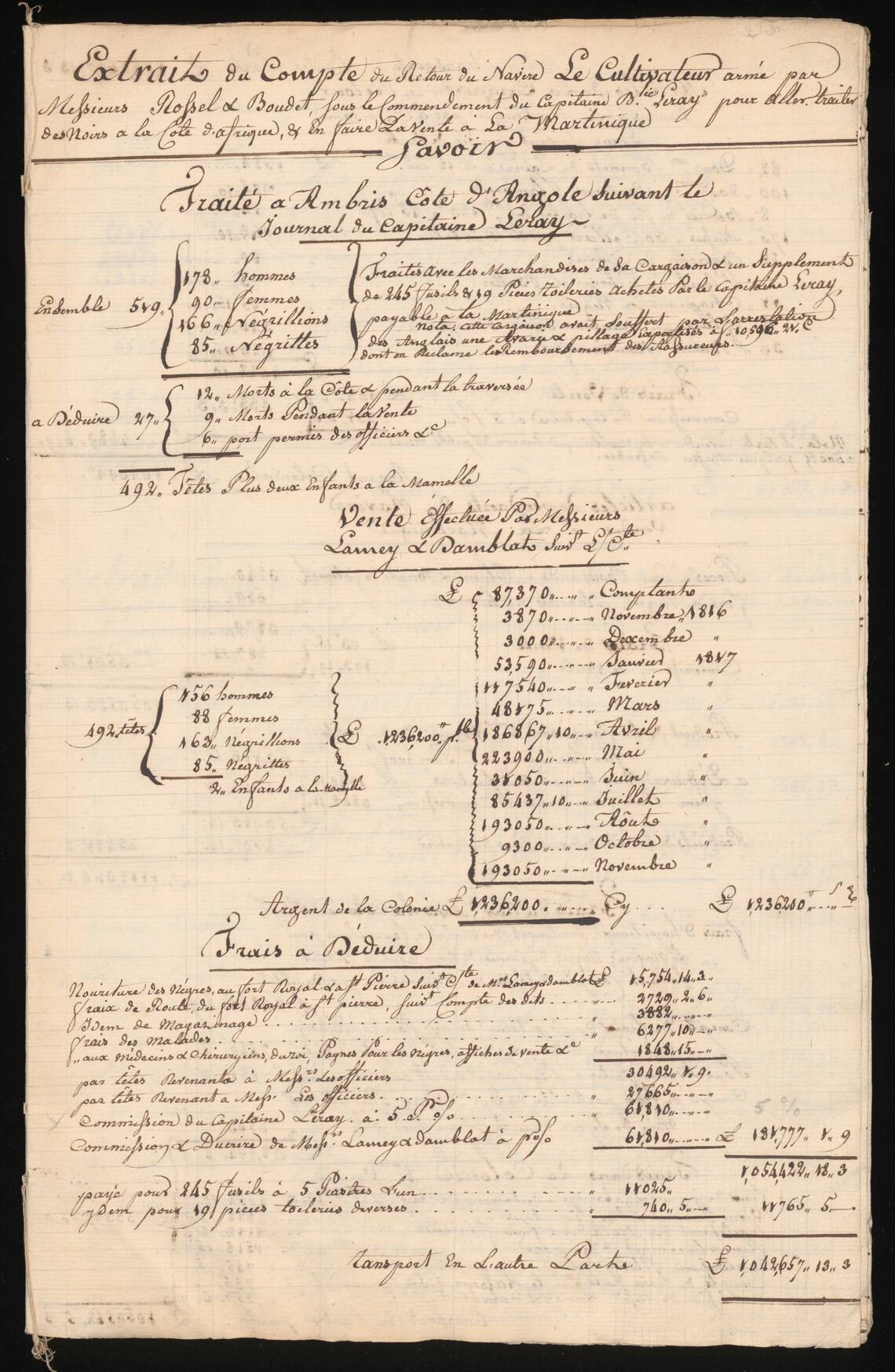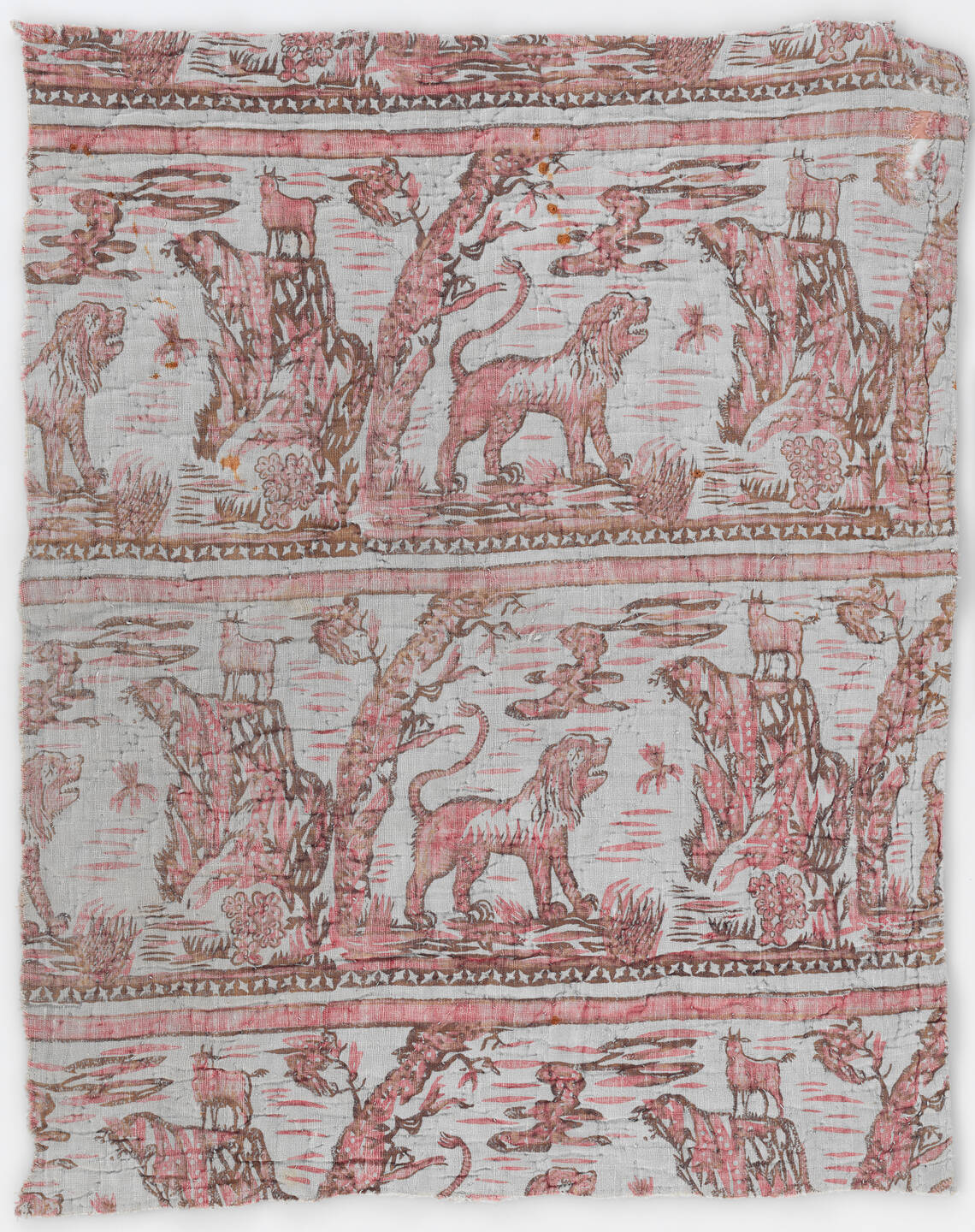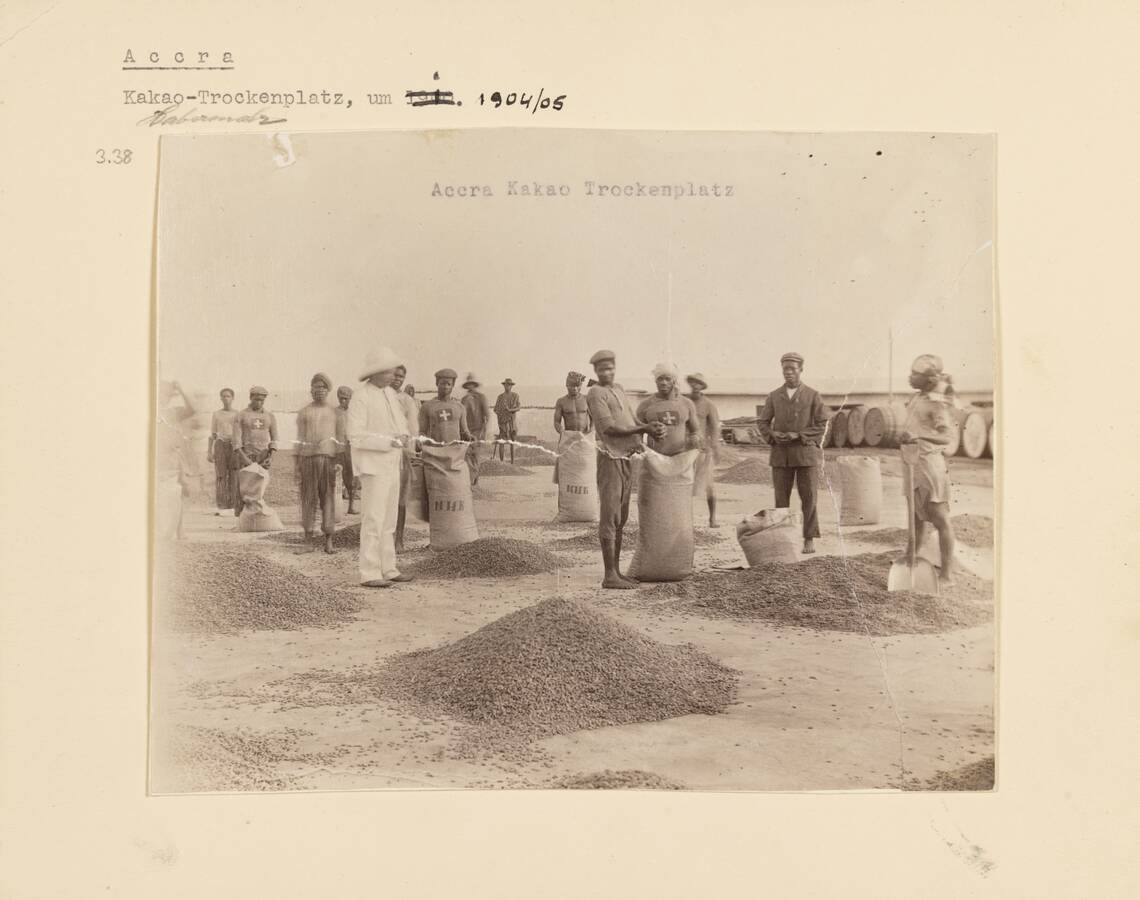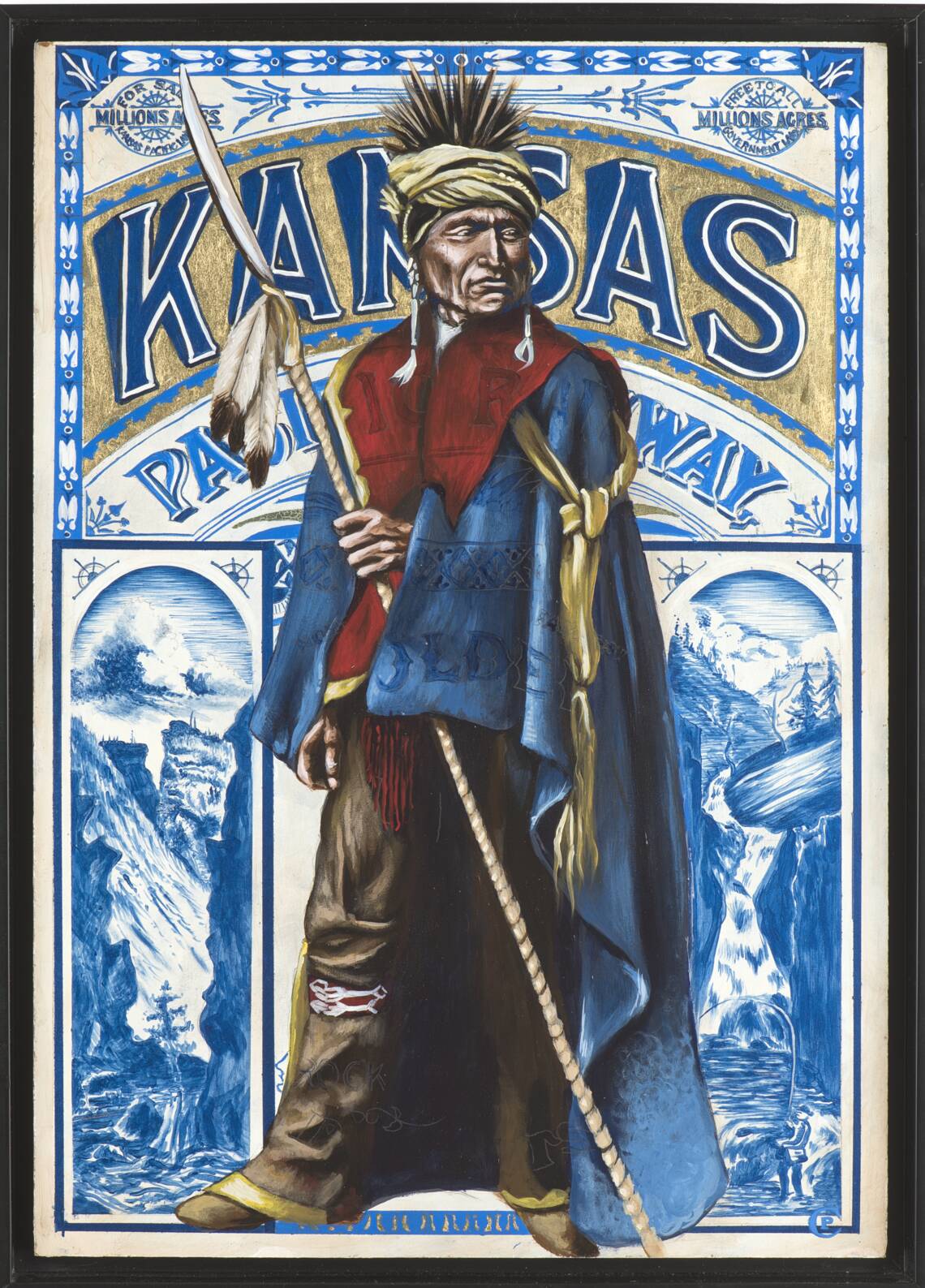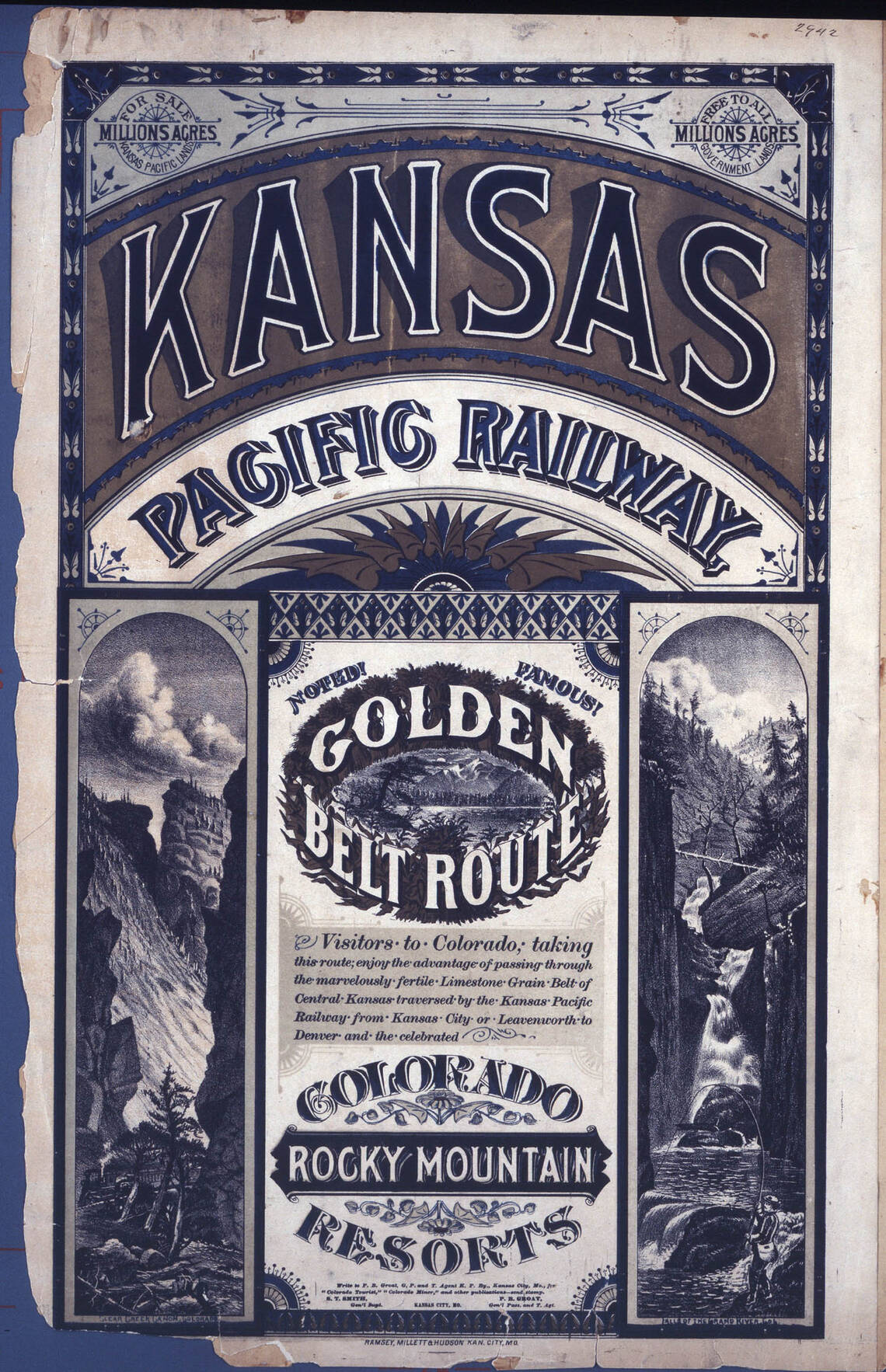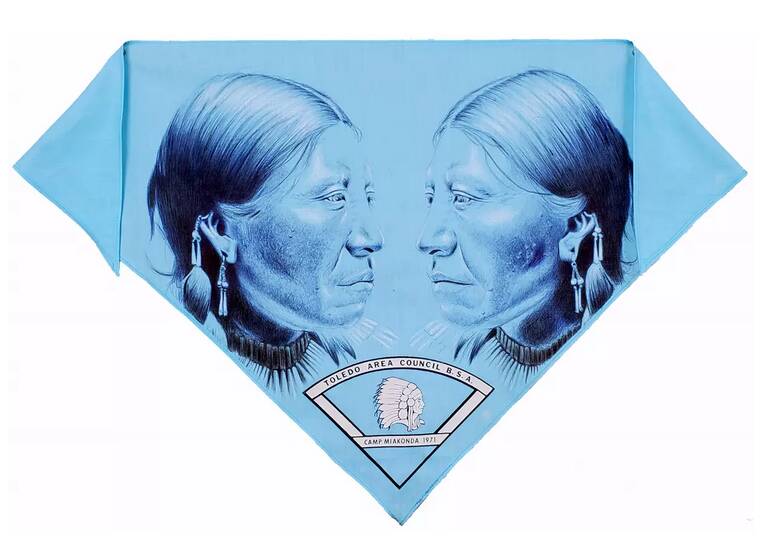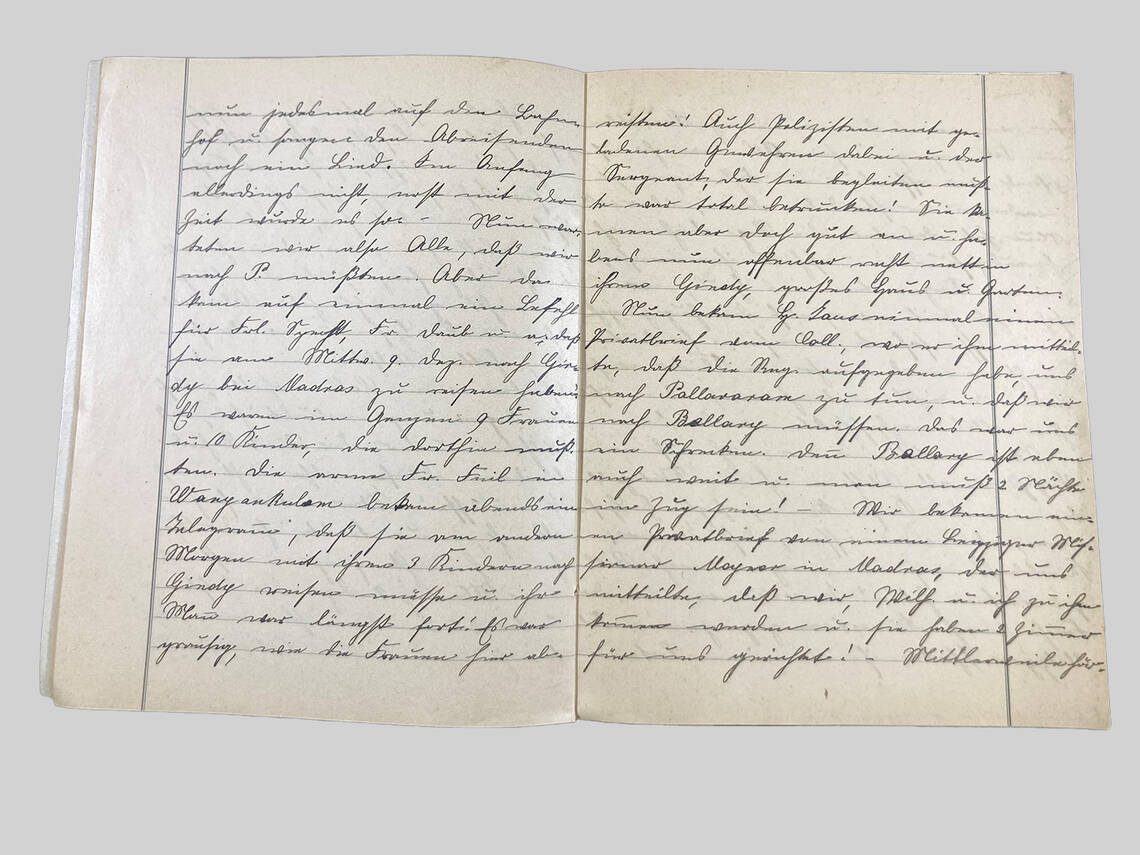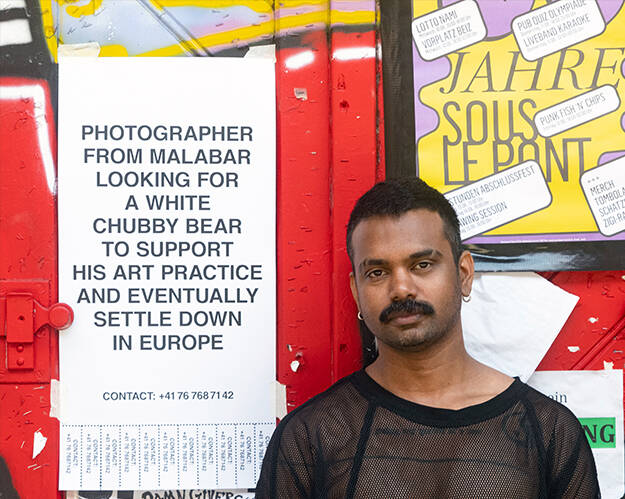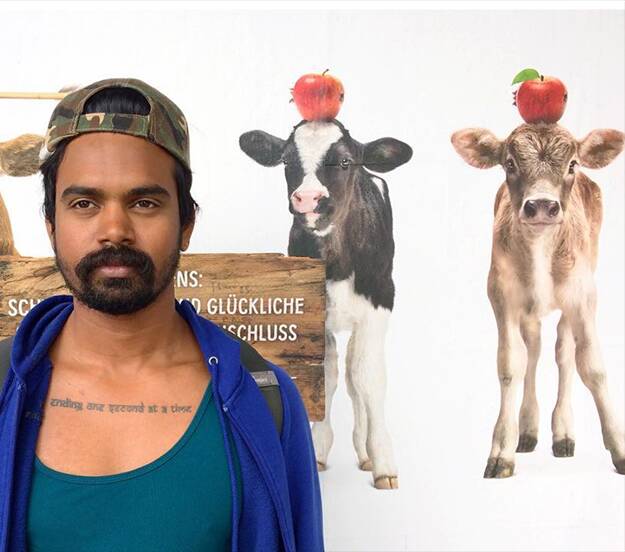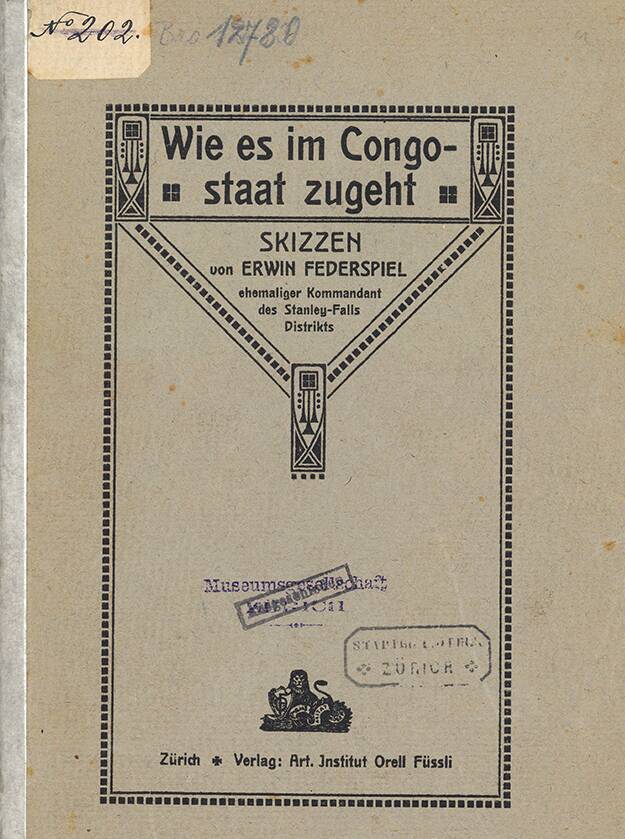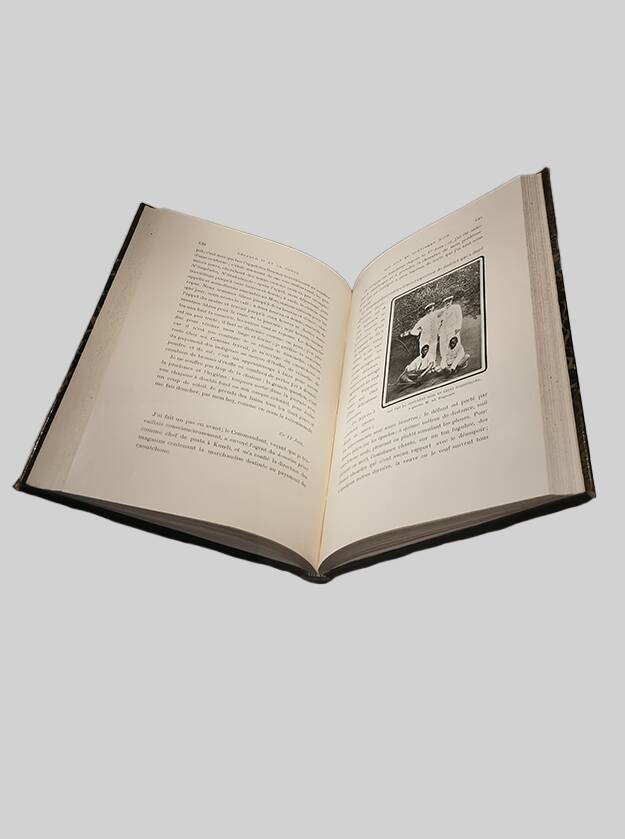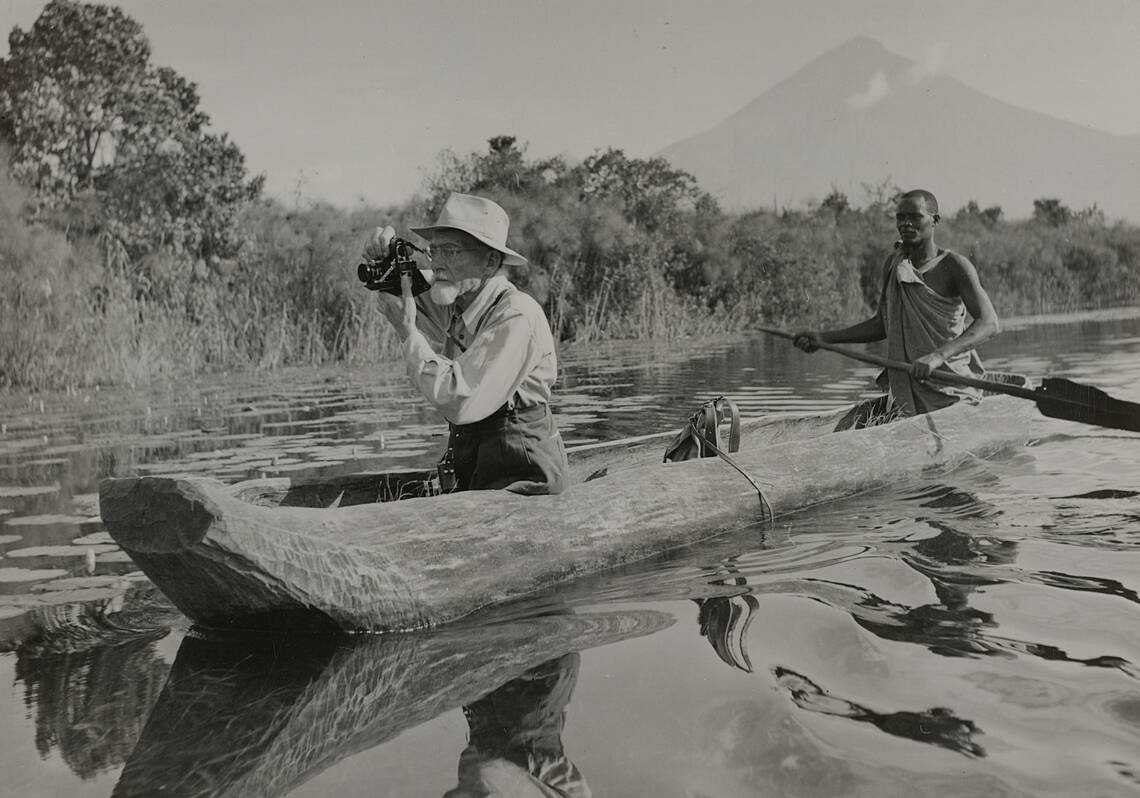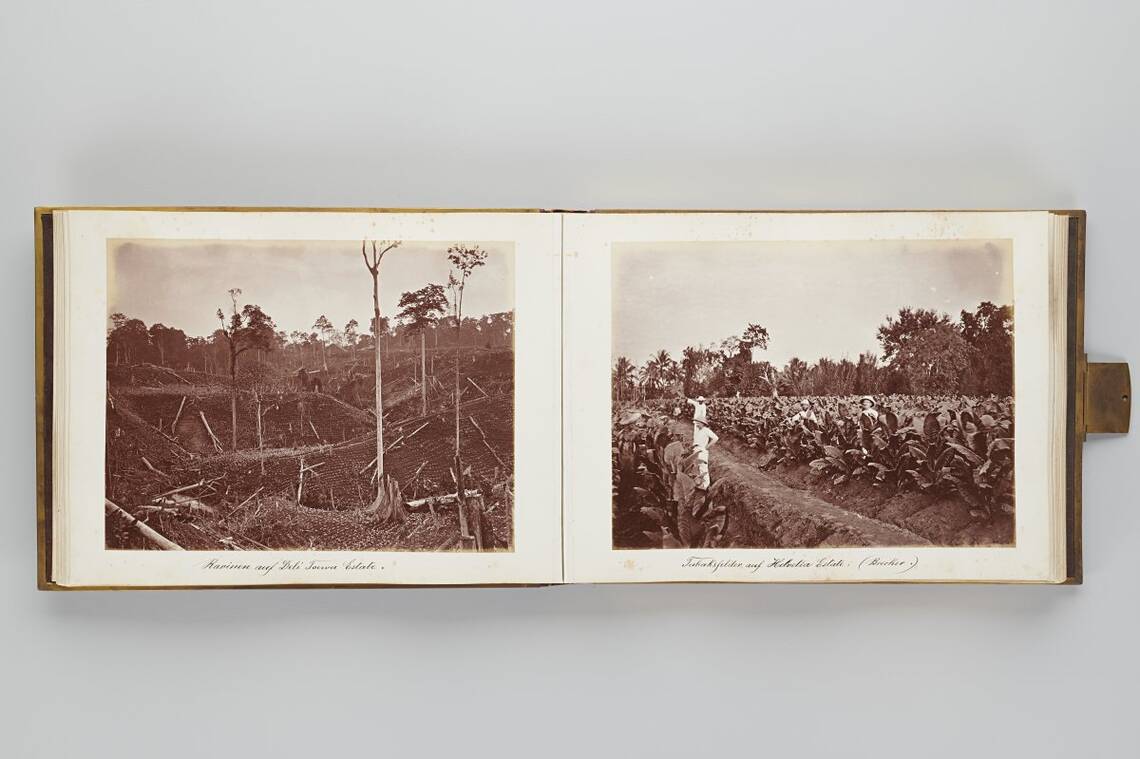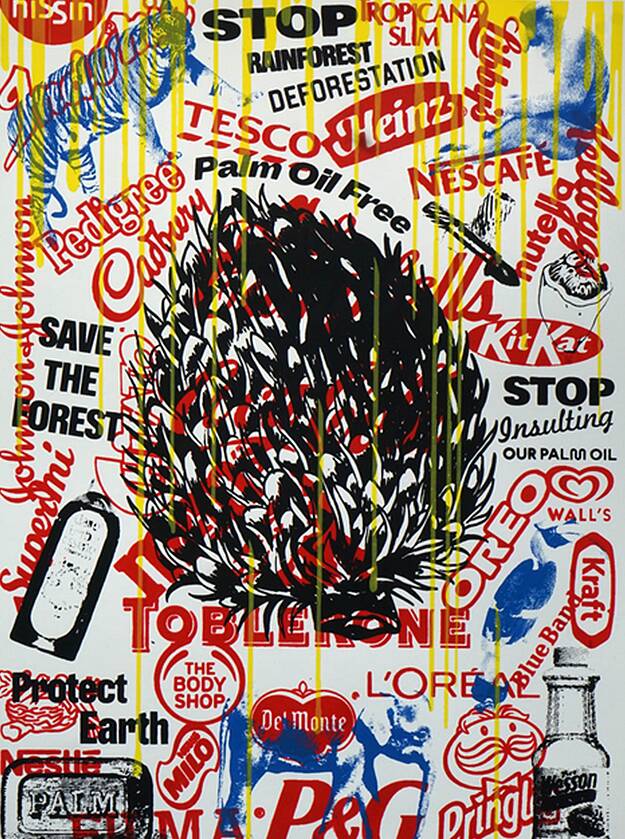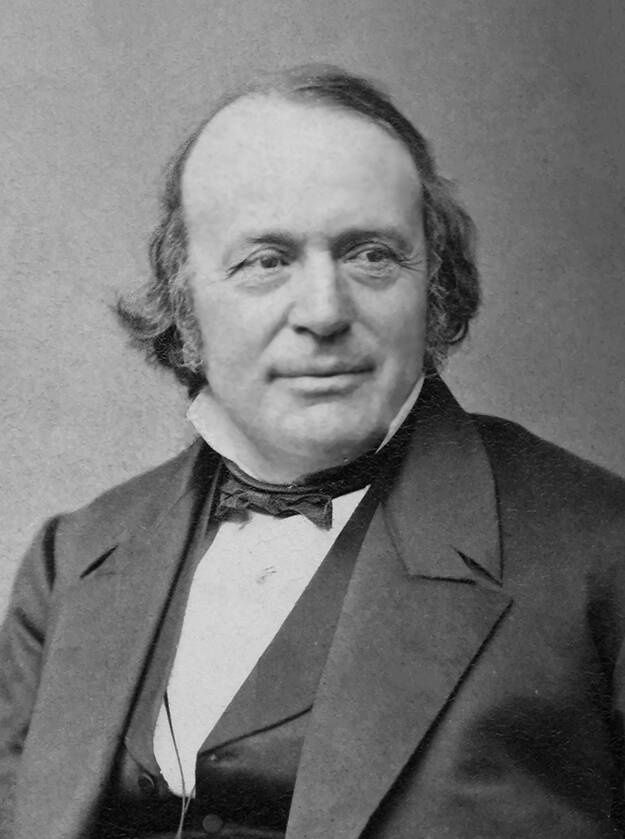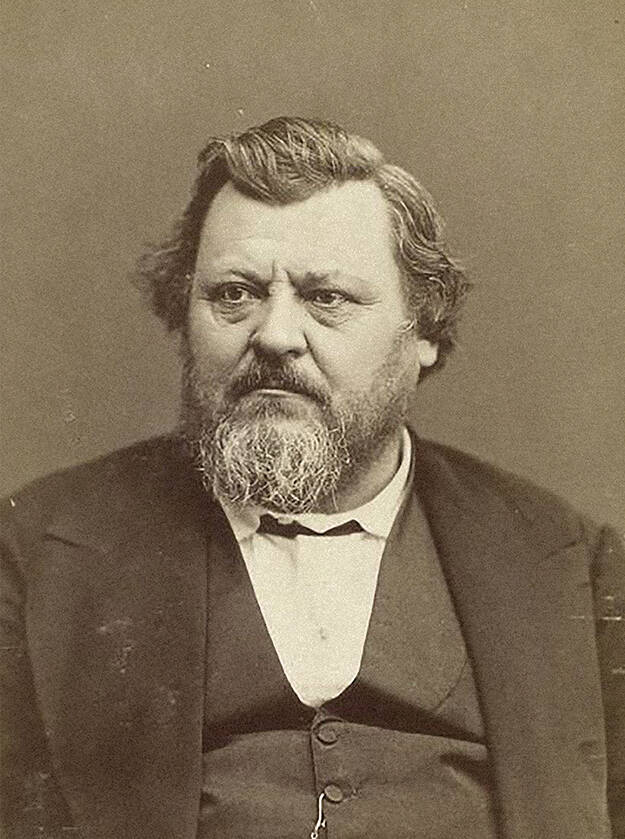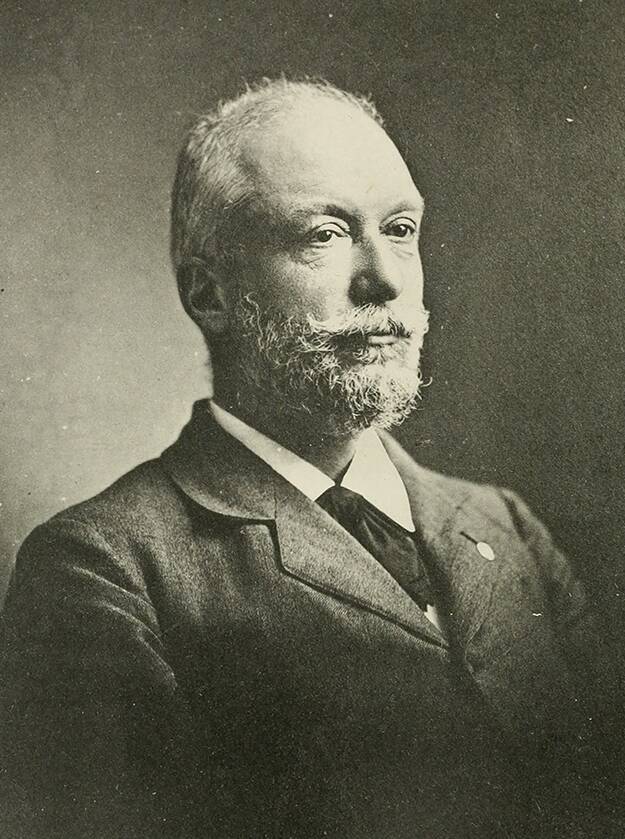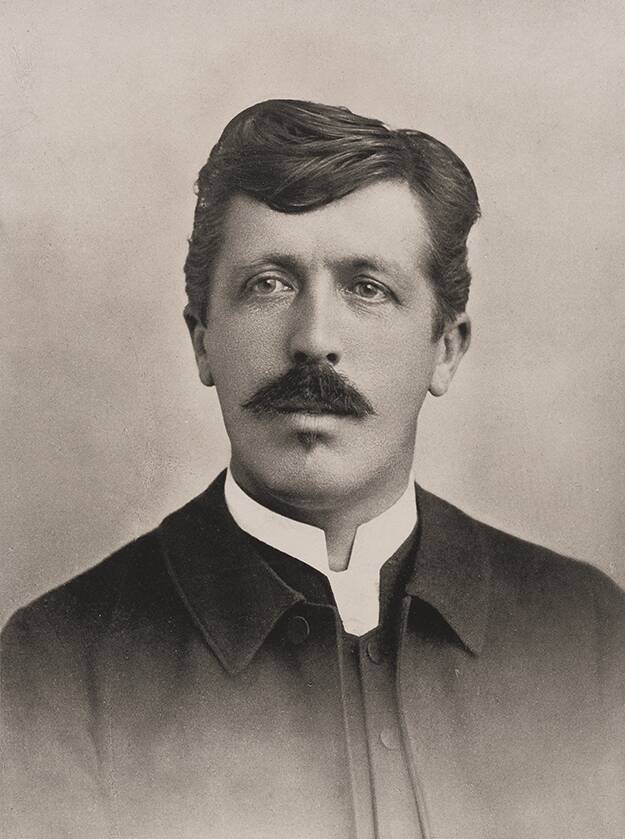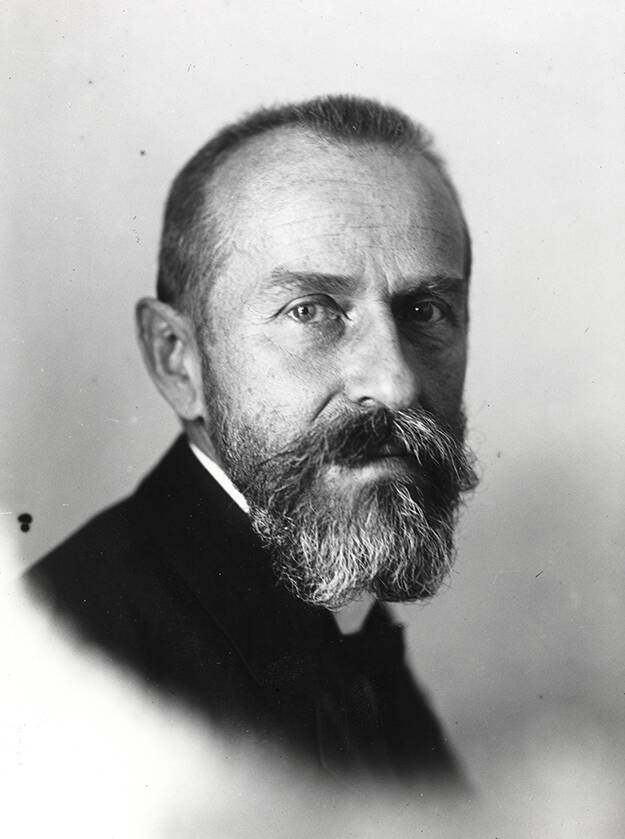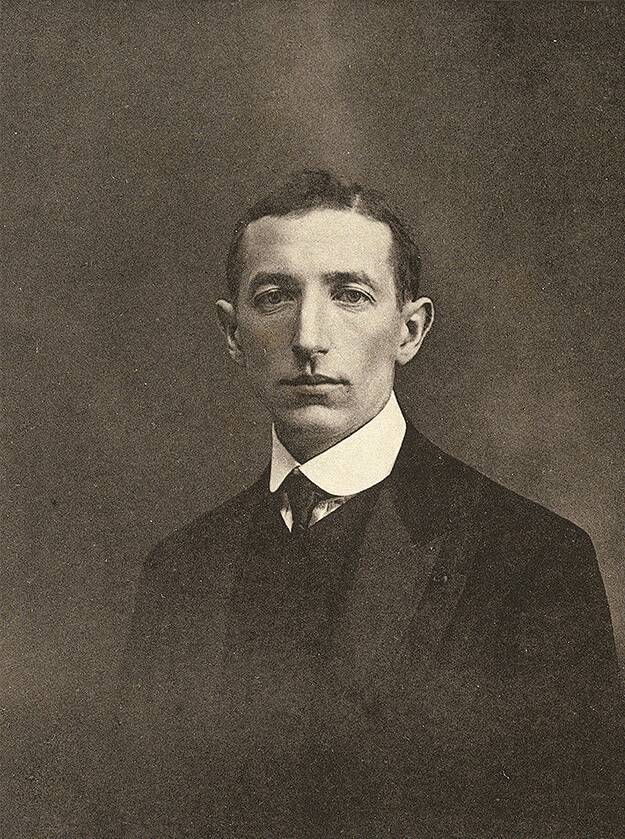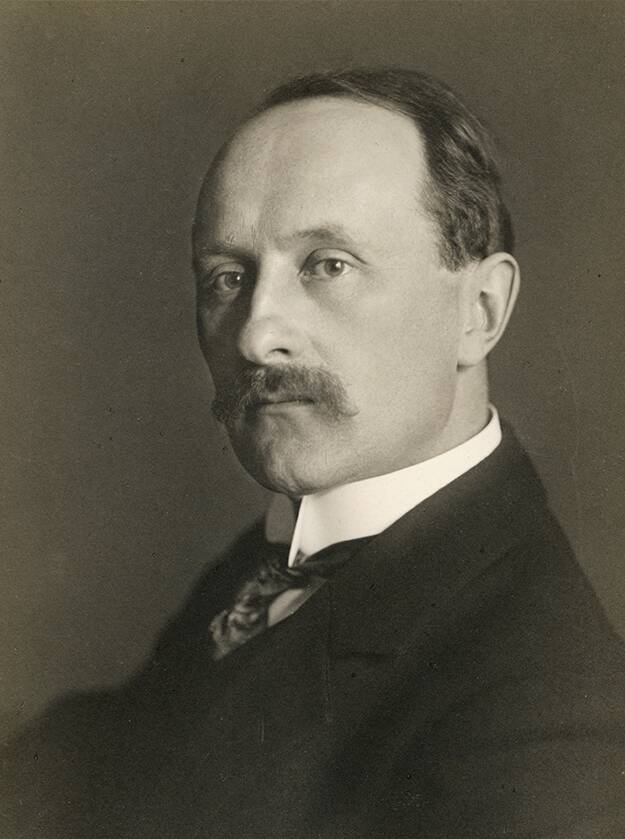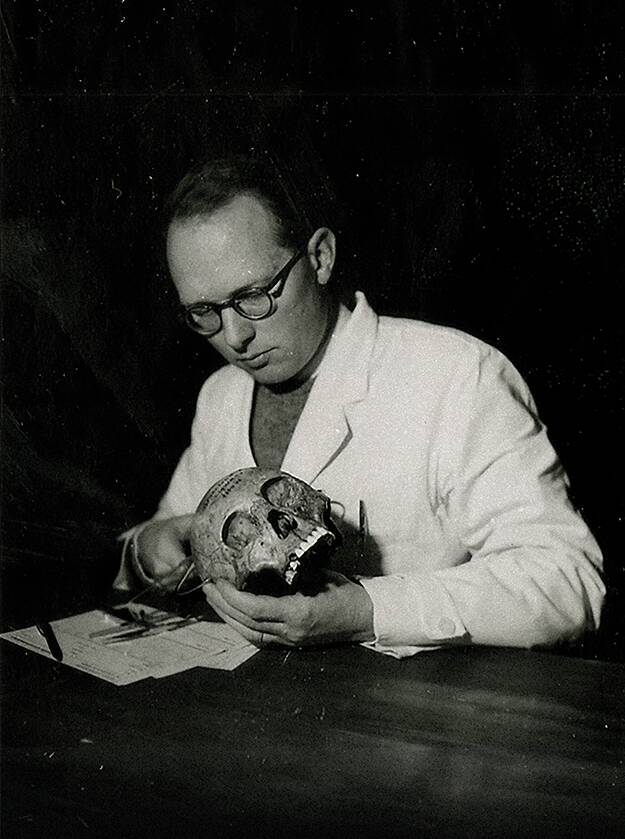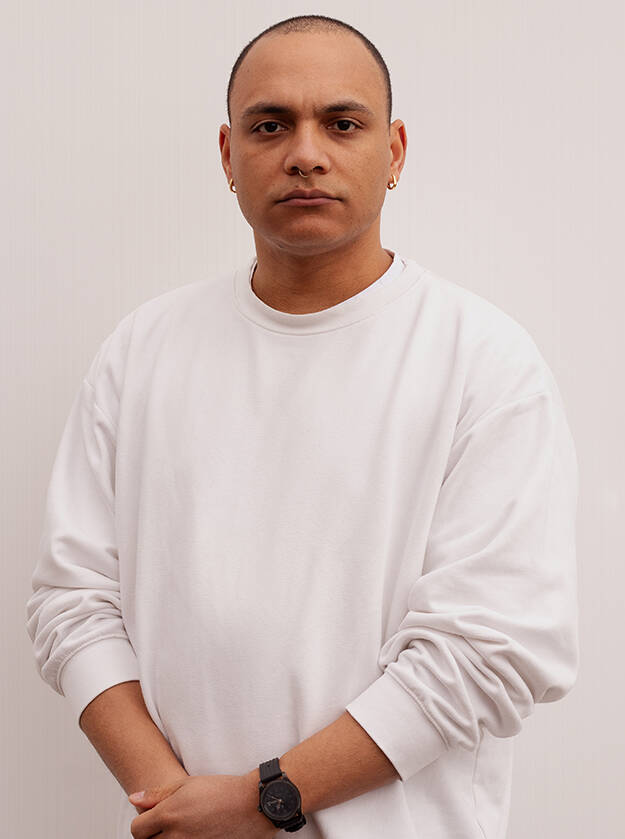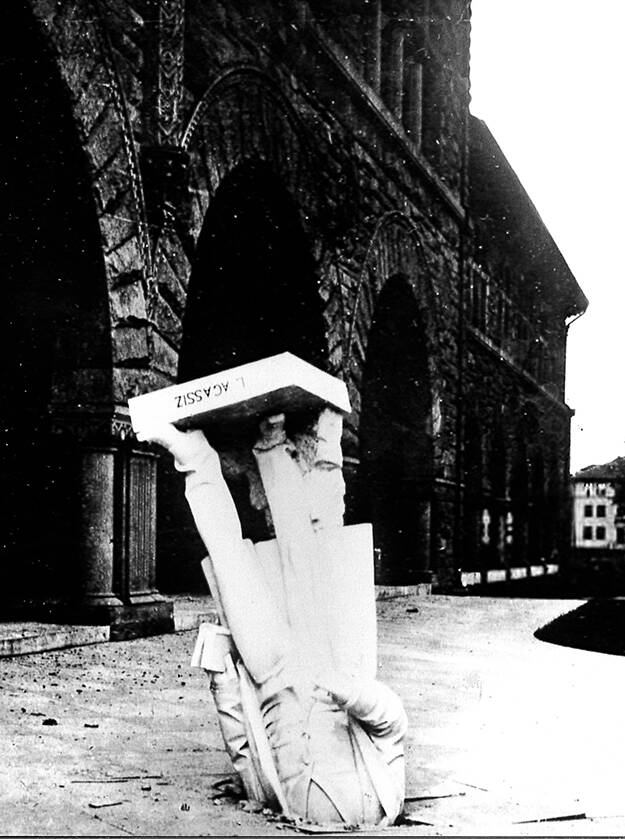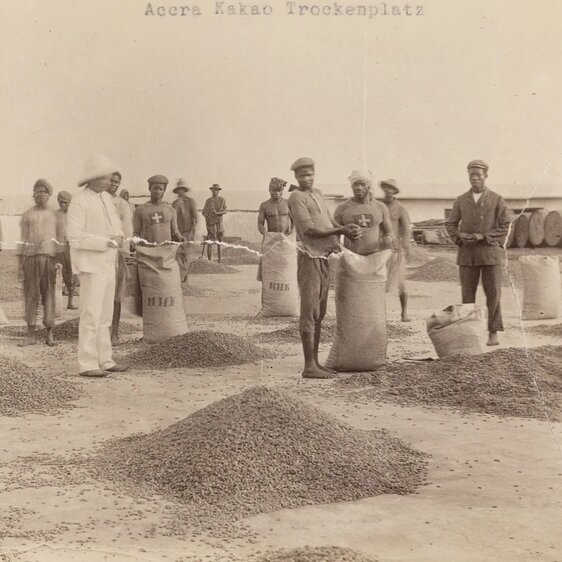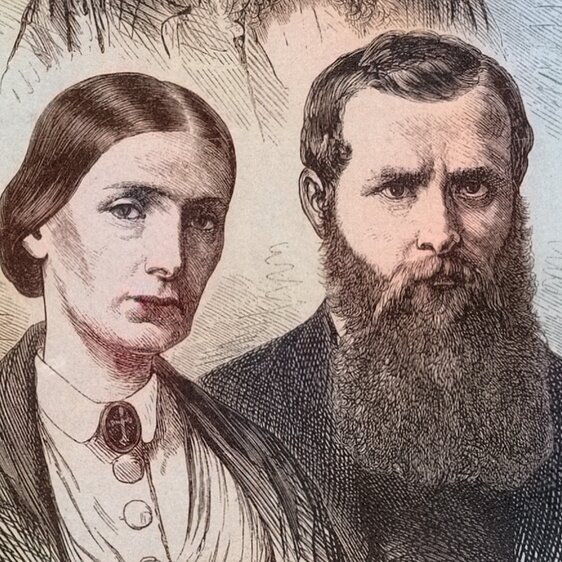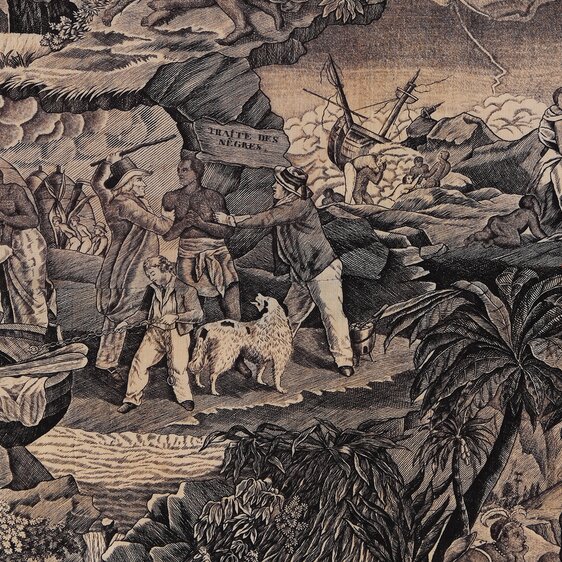-
Karfreitag 03.04.2026 10:00 - 17:00
Fr, 3.4.2026
10:00 - 17:00, Karfreitag
-
Karsamstag 04.04.2026 10:00 - 17:00
Sa, 4.4.2026
10:00 - 17:00, Karsamstag
-
Ostersonntag 05.04.2026 10:00 - 17:00
So, 5.4.2026
10:00 - 17:00, Ostersonntag
-
Ostermontag 06.04.2026 10:00 - 17:00
Mo, 6.4.2026
10:00 - 17:00, Ostermontag
-
Sechseläuten 20.04.2026 10:00 - 17:00
Mo, 20.4.2026
10:00 - 17:00, Sechseläuten
-
Tag der Arbeit 01.05.2026 10:00 - 17:00
Fr, 1.5.2026
10:00 - 17:00, Tag der Arbeit
-
Auffahrt 14.05.2026 10:00 - 17:00
Do, 14.5.2026
10:00 - 17:00, Auffahrt
-
Pfingsten 24.05.2026 10:00 - 17:00
So, 24.5.2026
10:00 - 17:00, Pfingsten
-
Pfingstmontag 25.05.2026 10:00 - 17:00
Mo, 25.5.2026
10:00 - 17:00, Pfingstmontag
-
Nationalfeiertag 01.08.2026 10:00 - 17:00
Sa, 1.8.2026
10:00 - 17:00, Nationalfeiertag
-
Lange Nacht der Museen 05.09.2026 10:00 - 17:00
18:00 - 23:59
Sa, 5.9.2026
Lange Nacht der Museen,
10:00 - 17:00
18:00 - 23:59
-
Lange Nacht der Museen 06.09.2026 0:00 - 2:00
10:00 - 17:00
So, 6.9.2026
Lange Nacht der Museen,
0:00 - 2:00
10:00 - 17:00
-
Knabenschiessen 14.09.2026 geschlossen
Mo, 14.9.2026
geschlossen, Knabenschiessen
-
Familientag 18.10.2026 10:00 - 17:00
So, 18.10.2026
10:00 - 17:00, Familientag
-
21.12.2026 10:00 - 17:00
Mo, 21.12.2026
10:00 - 17:00
-
22.12.2026 10:00 - 17:00
Di, 22.12.2026
10:00 - 17:00
-
23.12.2026 10:00 - 17:00
Mi, 23.12.2026
10:00 - 17:00
-
Heiliger Abend 24.12.2026 10:00 - 14:00
Do, 24.12.2026
10:00 - 14:00, Heiliger Abend
-
Weihnachten 25.12.2026 10:00 - 17:00
Fr, 25.12.2026
10:00 - 17:00, Weihnachten
-
Stephanstag 26.12.2026 10:00 - 17:00
Sa, 26.12.2026
10:00 - 17:00, Stephanstag
-
27.12.2026 10:00 - 17:00
So, 27.12.2026
10:00 - 17:00
-
28.12.2026 10:00 - 17:00
Mo, 28.12.2026
10:00 - 17:00
-
29.12.2026 10:00 - 17:00
Di, 29.12.2026
10:00 - 17:00
-
30.12.2026 10:00 - 17:00
Mi, 30.12.2026
10:00 - 17:00
-
Silvester 31.12.2026 10:00 - 17:00
Do, 31.12.2026
10:00 - 17:00, Silvester
-
Neujahr 01.01.2027 10:00 - 17:00
Fr, 1.1.2027
10:00 - 17:00, Neujahr
-
Berchtoldstag 02.01.2027 10:00 - 17:00
Sa, 2.1.2027
10:00 - 17:00, Berchtoldstag